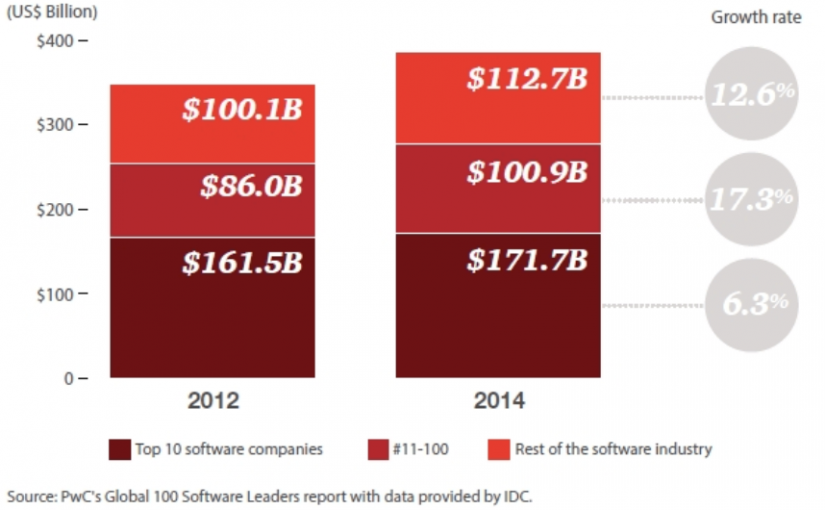90 Prozent seines Gesamtumsatzes – 2015 waren das 93,5 Milliarden Dollar – generiert Microsoft über seine Partner. Grund genug, in Toronto eine World Partner Conference abzuhalten, die gemessen an der Teilnehmerzahl alle Rekorde brach. Nie hatten sich mehr Softwarehäuser und Serviceunternehmen, die mit und durch Microsoft eigene Märkte erschließen, dafür interessiert, wohin die Reise geht, zu der Microsofts CEO Satya Nadella vor zwei Jahren mit der Devise „Mobile First, Cloud First“ den Startschuss gegeben hatte.
Denn die Basis, auf der Partner ihr Software- und Servicegeschäft aufbauen, wandelt sich mit aller Konsequenz. Da ist zum Beispiel der Wechsel auf Windows 10, den Microsoft ein ganzes Jahr lang durch den Verzicht auf Lizenzumsätze so schmackhaft gemacht hat, dass nun weltweit mehr als 350 Millionen Installationen existieren. In zwei Jahren, so schätzt Satya Nadella, soll die Milliardengrenze durchbrochen werden.
Windows 10 ist eine höchst interessante Entwicklungsplattform für Softwarepartner, die unter einem Betriebssystem parallel Lösungen für Personal Computer, Tablets, Surface oder Smartphone entwickeln können. Und sie ist auch deshalb außerordentlich interessant, weil sie die Plattform ist, auf der der Weg in die Cloud weitgehend barrierefrei ist.
Denn nicht nur offenbart die Cloud – mit Diensten wie Microsoft Azure – den Softwarepartnern die Nutzung neuer Technologien, die Microsoft über Services zur Verfügung stellt. Dazu gehört beispielsweise die intelligente Chatbot-Lösung Cortana, die als freundliche Bedienerhilfe auf Smartphones bislang noch kaum ausspielen konnte, was in ihr steckt. Auf der WPC demonstrierte Cortana am Beispiel der Fastfood-Kette McDonald´s, dass auch unsystematisch daher gefaselte Bestellungen durch Chatbots in eine vernünftige, maschinenlesbare Order umgewandelt werden können.
Satya Nadella war es wichtig, den Partnern aufzuzeigen, dass die Cloud nicht nur ein neues Geschäftsmodell offeriert, sondern dass sich vor allem neue Anwendungsmöglichkeiten durch Services ergeben, die von Microsoft nach und nach in der Cloud und als cloudgestützte Entwicklungsumgebungen für die Partner bereitgestellt werden.
„Die Digitale Transformation gemeinsam bewerkstelligen“, war denn auch das Mantra, dass Microsoft nicht müde wurde, an den drei Tagen von Toronto zu verkünden. Das geschah einerseits durch die visionäre Performance des indisch-stämmigen CEOs. Es geschah aber auch durch die neue Channel-Chefin Gavriella Schuster, die seit wenigen Wochen als Microsoft Vice President der Partner Division fungiert und Phil Sorgen beim Umbau der Partner-Community ablöst.
Nicht nur, sagte Schuster, sind Microsofts Partner durchweg erfolgreicher als ihre direkten Konkurrenten außerhalb der Microsoft-Gemeinde. Sie sind vor allem dann besonders erfolgreich, wenn sie den Gang in die Cloud schon angetreten haben. Wer mehr als 50 Prozent seines Umsatzes mit Cloud-Diensten generiert, rechnete sie ihren Partnern vor, erzielt höhere Margen als die, die nur zaghaft in die Cloud investieren. Das muss nicht verwundern. Denn wer bereits den größten Teil seines Umsatzes durch die Cloud erwirtschaftet, hat die verlustreiche Phase des Übergangs schon hinter sich.
Aber die nächste Zahl, die Schuster präsentierte, hatte es in sich: Auf einen Dollar Cloud-Umsatz für Microsoft kommen 5,84 Dollar für die Partnerschatulle, die aus eigenen Services, Zusatzprodukte und Wartungseinnahmen entstehen. Damit reklamiert Microsoft einerseits, dass die Company inzwischen zu einer der größten Umsatzmaschinen der Welt avanciert ist. Schuster machte auch den Partnern deutlich, dass mehr eigenständige Cloudservices auf Microsoft-Plattformen auch mehr Wachstumspotenzial für die Partner bedeuten. Und die Message dahinter war klar: Je mehr die Partner in der Cloud leisten, umso mehr Freude kommt auf – bei Microsoft, den Partnern und den Kunden.