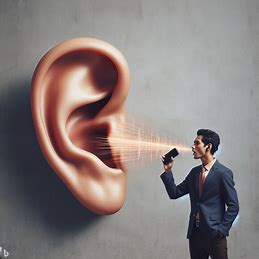Es ist ja nicht so, als würde es bei der Digitalisierung in Deutschland am Geld fehlen:
Anfang des Monats sicherte sich das Heidelberger KI-Startup Aleph-Alpha in einer Finanzierungsrunde eine halbe Milliarde Euro, mit der nun ein äußerst ehrgeiziges Ziel in Angriff genommen werden soll. Es geht um nicht weniger als darum, Deutschland in Sachen Künstlier Intelligenz voranzubringen und weltweit wettbewerbsfähig zu machen. Hinter dieses Ziel stellen sich Unternehmen wie SAP, Bosch, die Schwarz-Gruppe, zu der die Discounter Lidl und Kaufland gehören, der Unternehmer Harald Christ und der US-amerikanische HP-Konzern. Die Finanzierungsrunde wurde stark vom Bundeswirtschaftsministerium gestützt.
Doppelt so viel, nämlich eine Milliarde Euro, hat die KfW Capital, die Beteiligungsgesellschaft der staatlichen Förderbank KfW, für den „Wachstumsfonds Deutschland“ gesammelt, der insbesondere Startups unter die Arme greifen soll. Überall dort, wo klassische Venture Capitalists nicht zugreifen, oder wo ein strategisches Interesse für Deutschland besteht, soll der Fonds eingreifen, in den vor allem Versicherungsgesellschaften wie Allianz, Munich Re und Signal Iduna Investiert sind. Aber auch der US-amerikanische Vermögensverwalter Blackrock hat sich engagiert, um zwei Drittel der Kapitalausstattung zusammenzubringen. Das restliche Drittel soll vom Bundeswirtschaftsministerium kommen.
Dort liegt auch der Projektvorschlag von Siemens und SAP sowie 48 weiteren Partnern aus Wirtschaft, Forschung und Verbänden zur konkreten Umsetzung des European Data Acts, der Unternehmen dazu verpflichten will, Betriebsdaten aus ihren Produkten mit Kunden und Partnern zu teilen. Konkret bedeutet das, dass die 50 Partner nun – also bis 2026 – eine digitale Plattform für den Datenaustausch in der Fertigungsindustrie aufbauen. In Verlängerung der X-Cloud-Initiative der frühen zwanziger Jahre heißt das Projekt Factory-X. Ein vergleichbares Projekt für die besonderen Belange der Automobilindustrie ist unter dem Titel Catena-X unterwegs. Eine positive Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums für die Förderung der Projekte steht allerdings noch aus.
Das wäre bis Oktober 2023 reine Formsache gewesen. Doch jetzt, nach dem Verdikt des Bundesverfassungsgerichts, drückt ein Monster mit zehn Nullen auf den Bundeshaushalt für 2024, während möglicherweise auch der Haushalt 2023 als verfassungswidrig erkannt werden wird. Derzeit dürfen keine neuen Ausgabenzusagen gemacht werden. Wenn die Schuldenbremse nicht gekippt wird, verscherbelt Deutschland seine Zukunft.
Und als wäre dies nicht schlimm genug, zeigt die Halbjahresbilanz der Bundesregierung zur Digitalisierung von Verwaltungsbehörden, dass aktuell kaum mehr Engagement bei der Umsetzung von Digitalprojekten gezeigt wird, als in den Vorgänger-Regierungen unter Angela Merkel, die ihre 575 Einzelziele krachend verfehlt hatten. Die Ampel hatte sich insgesamt 334 Vorhaben in den Koalitionsvertrag geschrieben, von denen derzeit 43 Aktivitäten, also rund 13 Prozent, abgeschlossen sind. Weitaus mehr, nämlich 60 Vorhaben, sind noch nicht einmal in Angriff genommen worden.
Dabei bringt es die Natur der Zählweise mit sich, das Kleinstprojekte in der Statistik den gleichen Stellenwert haben wie Großvorhaben. Zu Letzteren – und leider auch zu den Unerledigten – gehören die Digitalisierung der Verwaltung und der Digitalpakt 2.0 für die Digitalisierung der Schulen – „also zwei Säulen, die für ein digitaleres Deutschland unerlässlich sind“, resümiert Bitkom-Präsident Ralph Wintergerst im Gespräch mit der Wirtschaftswoche.
Unter diesen Vorzeichen konnte in Jena weniger von einem Digital-Gipfel der Bundesregierung gesprochen werden, als vielmehr von einem Digital-Tal der Tränen, durch das sich Deutschland irgendwie hindurch zu fummeln versucht. Wie´s läuft und wo´s läuft zeigt in der Regel ein Blick auf Digitalprojekte unter der Führung US-amerikanischer Tech-Companies oder hinter den weitgehend verschlossenen Türen chinesischer Konzerne unter staatlicher Kontrolle. Sie operieren bei der Digitalisierung, in der Cloud und erst recht bei Künstlicher Intelligenz mit Summen in der Größenordnung des deutschen Haushaltslochs. Das ist die bittere Realität.
Deutschland drohe deshalb zu einer „digitalen Kolonie“ unter US-amerikanischer und chinesischer Führung zu verkommen, fürchtet Ralph Wintergerst. „Die Wirtschaft muss ihren Kunden selbst digitale Produkte anbieten, sonst bleibt am Ende nur die Hardware bei den Autos oder im Maschinenbau“, fürchtet er. „Damit wird künftig niemand lange wettbewerbsfähig bleiben.“ Was uns dann bleibt, sind nur noch Nullen.