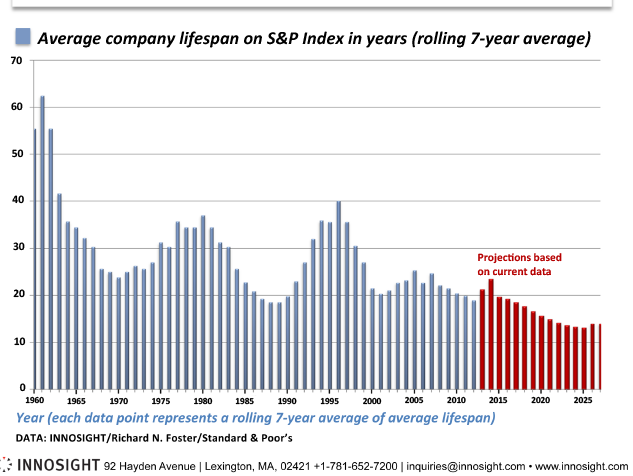Was waren das für Zeiten, als wir noch unbedacht und achselzuckend ausrufen konnten „…oder wenn in China ein Sack Reis umfällt!“ Der chinesische Sack Reis ist uns inzwischen näher als das berühmte Hemd, während wir kaum noch Rock zum Jackett sagen und deshalb auch diese Volksweisheit schon gar nicht mehr richtig deuten können. Dafür fängt jetzt bei uns der frühe Vogel den Wurm – ein aus dem angloamerikanischen Sprachraum eingebürgertes Sprichwort -, während die Morgenstunde schon lange kein Gold mehr im Mund hat, sondern höchstens Elmex.
Die Globalisierung hat auch vor unserem Sprachgebrauch nicht Halt gemacht. Und für viele Sprachpuristen ist das auch schon wieder Anlass, den Untergang des Abendlandes nahen zu sehen. Denn erst, so die Meinung der Populisten, raubt sie uns die Arbeitsplätze und dann die Identität. Dass diese Einschätzung einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht standhält, hat jetzt die Bertelsmann-Stiftung festgehalten, die Deutschland in ihrem Globalisierungsreport 2016 als einen der Gewinner der Globalisierung identifiziert. Den Deutschen geht es nicht nur besser, seit sich Märkte und Macher international vernetzen. Es gibt auch nur wenige (meist kleinere) Länder, in denen die Bevölkerung noch stärker profitiert hat.
Immerhin den Gegenwert eines Mittelklassewagens – rund 27.000 Euro – hat jeder Deutsche seit der Jahrtausendwende mehr zur Verfügung. Der (ehemalige) Exportweltmeister kann sich unverdrossen auf seine bewährte Strategie als Ausrüster der Weltwirtschaft (Maschinenbau) und Ausstatter der Mobilitätsgesellschaft (Automobilbau) stützen. Das gilt, auch wenn international immer mehr Konkurrenz in diesen und anderen Branchen erwächst.
Denn auch Wettbewerb hat seine guten Seiten. Der wachsende Konkurrenzdruck zwingt zur fortgesetzten Rationalisierung des Fertigungsprozesses. Nicht nur die Produkte werden durch Vernetzung und Digitalisierung immer smarter, ihre Produktion wird es auch. Sie wird allerdings auch immer komplexer. Deshalb ist es keine Überraschung, dass sich Industrie-4.0-Projekte länger hinziehen als die Niederschrift eines Zeitungskommentars, in dem mal wieder die zögerliche Umsetzung des Internets der Dinge durch die deutsche Industrie beklagt wird.
Welche Ausmaße ein solches Projekt annehmen kann, hat Siemens jetzt eindrucksvoll offengelegt. In einer völlig neu konzipierten Fertigungsstraße sammeln rund tausend Sensoren die Informationen über den Arbeitsfortschritt an der nahezu vollständig automatisierten Produktionslinie. Rund eine Million Daten kommen so täglich zusammen, die eine detaillierte Steuerung von Taktfrequenz, Produktvarianten, Stromverbrauch ermöglichen und das Einschreiten bei Störungen signifikant beschleunigen. Nur so, sind sich die Industrie-4.0-Planer sicher, können die Produktionsstandorte hierzulande gesichert werden.
Siemens ist groß und die Welt ist weit, möchte mancher einwenden. Aber auch der Mittelstand operiert an Rationalisierungsprojekten, die nicht nur dabei helfen, Kosten zu sparen, sondern auch die Effizienz und Flexibilität bei der Herstellung immer komplexer werdender Produkte stärken. In den USA, so besagt eine auf den englischsprachigen Raum beschränkte Industriestudie, haben sich bereits zwei Drittel der untersuchten mittelständischen Unternehmen für Cloud-Lösungen und den Einsatz von hochspezialisierten Apps entschieden. Dabei zeigt sich, dass sich die Firmen, die sich für eine Cloud-Strategie entschieden haben, ganz allgemein stärker in Innovationsinvestments engagieren.
Zugleich ist es interessant, dass nach einer deutschen Studie kleine und mittlere Unternehmen den Erfolg einer Innovation vor allem daran bemessen, wie sehr die neue Technik dabei hilft, Kosten zu sparen. In den USA hingegen wird Umsatzsteigerung als ultimativer Erfolgsfaktor gesehen. Dort wird Expansion um jeden Preis gesucht. Bei uns muss erst der Preis stimmen, ehe die Expansionspläne greifen.
Wir können uns nicht gegen die Globalisierung entscheiden, aber wir haben die Wahl der Mittel, wie und in welchem Umfang wir von der internationalen Vernetzung profitieren wollen. Der Wettlauf um die Märkte beginnt an der eigenen Produktionslinie. Die sollte uns immer noch näher sein als der sprichwörtliche Sack Reis.