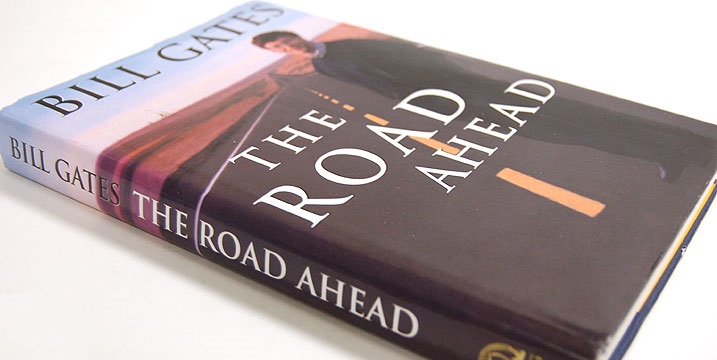Als Arthur C. Clarke sich vor 50 Jahren auf die „Space Odyssey“ begab, konnte sich niemand eine Welt vorstellen, die nicht von IBM dominiert würde. Deshalb nannte er seinen übermächtigen Computer „HAL“. Die Buchstaben sind im Alphabet jeweils eins vor „IBM“. Heute ist IBM nach zig Quartalen mit Umsatzrückgang – Entschuldigung – bedeutungslos.
Und als Bill Gates sich vor einem knappen Vierteljahrhundert auf den Weg zur „Road Ahead“ machte, vergaß er – zumindest in der Erstausgabe – das Internet. Niemand konnte sich vorstellen, dass es einmal eine Welt geben könnte, in der es keine von Microsoft beherrschte PC-Welt geben würde. Doch das missachtete Internet hat die Regeln des Marktes radikal verändert.
Und als Steve Jobs vor elf Jahren das iPhone ankündigte, konnte sich niemand vorstellen, dass die heruntergekommene Apple Corporation einmal das reichste Unternehmen der Welt sein würde und diesen Status auf ein Telefon stützen würde.
Und heute lesen wir von den mutmaßlich niemals endenden Vormachtstellungen der Internet-Giganten Google, Facebook, Alibaba, Tencent, Microsoft und Apple. Doch nichts, das lehrt uns die Vergangenheit, ist in Stein gemeißelt. Schon gar nicht wirtschaftliche Macht. Vor 20 Jahren hießen die größten Unternehmen in der „Fortune 500“-Liste Exxon, General Motors, IBM, British Petrol und Shell – und Microsoft. Heute ist nur noch Microsoft in dieser Liste.
Und das ist einem sensationellen Comeback zu verdanken, das einen Namen trägt: Satya Nadella. Da kann es nicht überraschen, dass das Wirtschaftsblatt Forbes dem dritten Microsoft-CEO inzwischen den Titel „CEO of the Year in Cloud Wars“ verliehen hat. Denn niemand hat wie er die Möglichkeiten erkannt, die sich aus der Bereitstellung von Cloud Services ergeben. Und niemand – weder Bill McDermott (SAP), Larry Ellison (Oracle), Jeff Bezos (Amazon), noch Larry Page und Sergey Brin (Google) – hat dabei die gesamte Entwickler-Kompetenz auf Services für die Enterprise-Kunden angesetzt.
Das zahlt sich jetzt aus. Bei der Ankündigung seiner Ernennung zum CEO hatte Microsoft eine Marktkapitalisierung von gut 300 Milliarden Dollar. Letzte Woche lag der Marktwert des Unternehmens auf mehr als dem doppelten Wert: 681 Milliarden Dollar. Einer der Gründe liegt darin, dass Microsoft das erste Unternehmen werden könnte, das mehr als 20 Milliarden Dollar mit Cloud Services umsetzen wird. In einer Zwölf-Monats-Prognose ist dieser Wert bereits überschritten worden. Aber was zählt, sind echte Umsätze aufs Jahr gerechnet. Und bis zum 30. Juni 2018 könnte es in der Tat klappen.
Natürlich haben SAP, Oracle, Amazon und Google ebenfalls sensationelle Erfolge in der Cloud. Aber keiner – nicht einmal SAP oder Oracle – hat in der Vergangenheit so stark auf Unternehmenssoftware aus der Cloud gesetzt wie Microsoft. Das liegt nicht allein daran, dass die historischen Zukäufe, die die Basis für die ERP-Suite Dynamics bilden, inzwischen in der Cloud verfügbar sind. Es liegt eher daran, dass sowohl Dynamics als auch die traditionelle Office-Suite inzwischen massiv durch künstliche Intelligenz aufgepeppt wurden. Wer Office oder Dynamics mit dem Zusatz „365“ nutzt, kann inzwischen auf Services zurückgreifen, die neben dem Sprachassistenten Cortana, Bilderkennung und Übersetzungsfunktionen auch smarte Features umfassen, die das Arbeitsleben leichter machen.
Satya Nadellas Leistung besteht nicht allein darin, die Cloud zur zentralen Plattform zu erheben und damit gewissermaßen den PC vom Thron zu stoßen. Seine wirkliche Leistung besteht darin, dass er unterschiedlichste Entwicklerteams vor die Aufgabe gestellt hat, KI-Funktionen in die klassischen IT-Angebote einzubauen. „Demokratisierung von künstlicher Intelligenz“ hat Satya Nadella das genannt. Und in der Tat hat die Devise, mehr Demokratie zu wagen, jetzt Erfolg.
Der „Cloud War“ ist noch lange nicht entschieden. Aber mit Webservices für das Internet der Dinge und künstlicher Intelligenz hat Microsoft zwei Wachstumsmärkte erobert. Das kommt einer Vorentscheidung nahe. Anders als IBM, die mit Watson vor allem exquisite, aber eben auch exklusive Lösungsangebote unterbreitet, hat Microsoft das Internet der Dinge und Systeme der künstlichen Intelligenz demokratisiert. Teilhabe nennt man das im Soziologendeutsch.
Satya Nadellas Aufstieg – und der von Microsoft in der Cloud – sind ein Mutmacher. Es zeigt, dass man sich unter neuen Geschäftsmodellen neu erfinden, neu aufstellen kann. Denn eigentlich war die Cloud der Sargnagel für den PC-Spezialisten Microsoft. Dass sie im Gegenteil für eine Lebensverlängerung gesorgt hat, liegt einzig und allein an der visionären Kraft des dritten Microsoft-CEO.