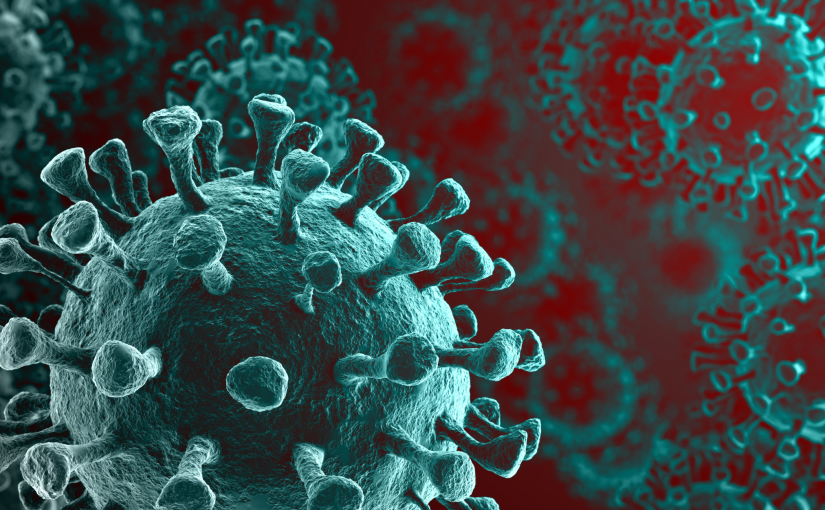Deutschland hat rund 30 Millionen Bundestrainer – das ist seit 1954 so. Und alle wissen besser als Jogi Löw, dem (noch) amtierenden tatsächlichen Bundestrainer, was zu tun ist, um „Die Mannschaft“ durch sportlichen Erfolg wieder zu einem marketingtechnisch wertigen Produkt zu machen. Ein Null-zu-Sechs gegen Spanien ist der negative Höhepunkt eines – die derzeit ausgesperrten Ultras würden sagen – „verkackten“ Jahres 2020. In etwas gehobeneren Sphären nennt man das ein „Annus horribilis“. Auf Schalke übrigens – aber aus anderen Gründen – würde man sowohl de einen als auch dem anderen Terminus zustimmen…
Deutschland hat inzwischen auch rund 50 Millionen Virologen – das ist erst seit diesem Jahr so. Und viele davon – sie selbst nennen sich „Querdenker“ – wissen es besser als die tatsächlichen amtierenden Pandemie-Experten. Ihre Namen kennt inzwischen praktisch jeder: Marylyn Addo, Klaus Cichutek, Christian Drosten, Alexander Kekulé, Jonas Schmidt-Chanit, Hendrik Streeck und natürlich Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut. Aber die meisten – also die, die nicht an Verschwörungstheorien glauben, sondern daran, dass eine vernunftbegabte Einsicht in die Notwendigkeit von Einschränkungen diese Virus-Epidemie in unserem Land eindämmen kann – folgen den Empfehlungen der echten Virologen. Und diese Empfehlung hieß seit März: einschränken, einschränken, einschränken. Egal, ob es sich dabei um persönliche Kontakte, um Reiseaktivitäten oder um Geschäftsprozesse entlang der Lieferkette handelt.
Sachsen zeigt nun, dass die „Quer“-Denker möglicherweise doch eher „Queer“-Denker waren – also mit Verlaub: Verrückte – und der Ausbreitung des Virus in ihrem Bundesland eher Vorschub geleistet haben. Schon schlagen selbst Mitglieder des Ethikrates vor, dass man bei einer notwendig werdenden Triage – also der Frage, wer zu heilen ist und wer zu leiden hat –die Teilnahme an den Querdenker-Demos als Kriterium ansetzen sollte. Aber schon vor Monaten haben ansonsten vernunftbegabte Menschen aus Politik und Wirtschaft gefordert, dass wir eine Triage zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und individueller Freiheit treffen müssen. Die These: Je stärker wir der Gesellschaft die individuellen Freiheiten rauben, desto größer sind die Überlebenschancen der Wirtschaft. Aber umgekehrt gilt auch die These: Je stärker wir der Wirtschaft durch Milliardenhilfen unter die Arme greifen, desto eher können wir die Armen im Lande vor dem Existenzminimum bewahren. – Soloselbständige, Künstler und die Hotellerie und Gastronomie natürlich ausgenommen. Sie sind – Überraschung, Überraschung – doch nicht so systemrelevant, wie es Künstler vielleicht geglaubt haben.
Die Subventionen allerdings gelten als systemrelevant – selbst dort, wo mit Hilfe von Kurzarbeitergeld totgeweihte Industrien an die Beatmungsgeräte angeschlossen wurden. Auch das ist offensichtlich eine Frage der Triage. Entscheidend sind nicht die Überlebenschancen – und schon gar nicht die Versäumnisse von „Que(e)rdenker-Vorständen“, die die Realität von eMobilität, eCommerce oder eNergy geleugnet haben –, sondern vielmehr die Anzahl der Arbeitsplätze, die mit diesen Industrien verbunden sind. Es geht also gar nicht um Innovation, sondern um Bestandsbewahrung.
Nicht anders entwickelte sich im zurückliegenden Jahr der Fortschritt zur digitalen Transformation. Die meisten Unternehmen verschoben die Investitionen in Digitalisierung von der strategischen Ausrichtung auf neue Geschäftsmodelle zur taktischen Ausrichtung auf das Homeoffice. Doch persönliche Meetings durch Slack, Skype oder Teams zu ersetzen, verschafft noch keinen wirtschaftlichen Vorsprung. 2020 mag vielleicht in die Annalen eingehen als das Jahr, in dem viele – gerade auch mittelständische Unternehmen – ihr digitales Erwachen erleben. Aber sie reiben sich gerade erst die Augen über das, was durch Digitalisierung möglich ist.
Wir hätten das Jahr 2020 aus einem Annus horribilis in ein echtes Annus digitabilis wandeln können, wenn wir die Horror-Investitionen statt in den Erhalt von Arbeitsplätzen und Gemeinplätzen in echte Erneuerungen gesteckt hätten. Die Automobilindustrie hat vorgemacht, wie sie sich ihre Versäumnisse in der Krise durch staatliche Fördermaßnahmen nachträglich hat verzuckern lassen. Eine echte Innovationspolitik sieht freilich anders aus. Sie fördert künstliche Intelligenz, Robotics, das Internet der Dinge und viele andere Zukunftsthemen wie beispielsweis Quantencomputing nicht mit ein paar läppischen Milliarden über Jahre gestreckt, sondern über Soforthilfemaßnahmen mit der Bazooka, wie es Finanzminister Olaf Scholz gesagt hat. Da das nicht geschehen konnte, ist für mich das Jahr 2020 wirklich ein Annus horribilis.
Liebe BonnBlog-Gemeinde, ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben, uns zusammen dessen ungeachtet Optimismus für das Morgen und die Hoffnung auf eine erfolgreiche, gesunde und friedvolle Zukunft im Jahre 2021.