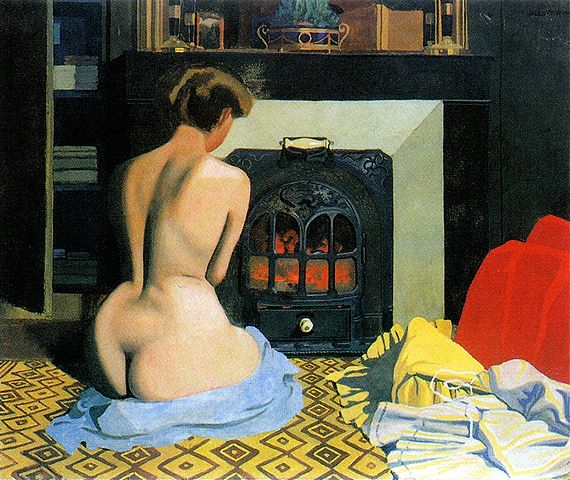Wer hätte das gedacht: Die deutschen Startups scheinen sich erstaunlich gut in der Corona-Krise zu behaupten. Zwar haben sie – wie alle anderen Unternehmen im Lockdown auch – mit deutlichen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Aber Gesundschrumpfen ist für sie keine Option. Nur 12,8 Prozent – also jedes achte Startup – denken an Personalabbau. Die Aufträge bei Dienstleistern zu stornieren, ist auch nur für 14,9 Prozent im Gespräch. Das ergab der jetzt vorgestellte achte Deutsche Startup Monitor, der auf einer Befragung im Frühsommer beruht. Die Studie wurde vom Lehrstuhl für E-Business und E-Entrepreneurship der Universität Duisburg-Essen wissenschaftlich begleitet und durch PricewaterhouseCoopers unterstützt. Danach hat jeder vierte Gründer darüber nachgedacht, für seine Mitarbeiter Kurzarbeitergeld zu beantragen. Zum Vergleich: in der Gesamtwirtschaft sind es mehr als 70 Prozent der Unternehmen, die Kurzarbeit beantragt haben.
Dabei ist die durchschnittliche Teamgröße der deutschen Startups inzwischen auf 14 Mitarbeiter angestiegen. Damit kann die deutsche Startupszene mit geschätzten 50.000 Mitarbeitern inzwischen ein nennenswertes Segment am Arbeitsmarkt für sich beanspruchen. Allerdings handelt es sich dabei um besonders hoch qualifizierte Mitarbeiter, die nicht nur die digitalen Tugenden beherrschen, sondern in disruptiven Geschäftsmodellen denken. Da liegt es nahe, dass diese hochgeschätzte Ressource Mensch möglichst ans Unternehmen gebunden bleibt. Ja, mehr noch: nach der Krise wollen 90 Prozent der Startups heftig Personal rekrutieren. Im Durchschnitt planen sie mit weiteren sechs Mitarbeitern in den kommenden zwölf Monaten. Allein bei den im Deutschen Startup Monitor befragten Unternehmen wäre das ein Zuwachs von mehr als 11.000 Arbeitsplätzen.
Deshalb sparen Startups lieber in anderen Bereichen. So wollen zwei von drei Gründern die eigene Produktentwicklung stärker auf sichere Umsatzbringer fokussieren. Interessant ist dabei, dass die Startups die Corona-Krise auch als Marktchance sehen und zusätzliche digitale Angebote entwickeln wollen – das reicht vom Lieferdienst bis zu Gesundheits-Trackern. Aber gut die Hälfte denkt darüber nach, geplante Investitionen zu verschieben.
Davon ausgenommen sind allerdings weitgehend Globalisierungsbestrebungen: Nahezu zwei Drittel planen trotz aktueller Unsicherheiten eine weitere Internationalisierung. Dabei sind es vor allem die Länder der Europäischen Union, in die es die Startups zieht. Nordamerika und die europäischen Nicht-EU-Länder sind zu je 30 Prozent das Ziel der Internationalisierung. Startups planen also eine zügige Marktausweitung.
Auch dabei setzen Startups auf die Ressource Mensch. Schon jetzt haben 26,6 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Migrationshintergrund. Und auch bei den Gründerinnen und Gründern ist der Anteil der Menschen mit ausländischen Wurzeln höher als in der Gesamtwirtschaft. Interessantes Aperçu dazu: ihr Anteil ist in der Metropolregion Rhein/Ruhr besonders hoch, dort ist aber der Anteil von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund besonders niedrig.
Die Angst, wertvolle Mitarbeiter an Mittelständler und globale Konzerne zu verlieren, hat lange Zeit Kooperationen zwischen etablierten Unternehmen und Startups behindert. Doch die Krise schmiedet neue Bettgesellen: die Mehrheit der Startups hat im vergangenen Jahr die Partnerschaft mit mittelständischen Champions gesucht – mehr noch als mit Startups aus dem eigenen Ökosystem. Die Zusammenarbeit zwischen „Unternehmen mit Vergangenheit“ und „Unternehmen mit Zukunft“ ist aus mehreren Gründen sinnvoll: die einen haben Kunden und Märkte, die anderen Produktinnovationen und disruptive Geschäftsmodelle. Und beiden fehlt es an Fachkräften. Wo sie fehlt, ist die Ressource Mensch der größte Wachstumshemmer. Das gilt für die Etablierten ebenso wie für die Newcomer. Co-Working und Co-Innovation ist deshalb nicht nur in Krisenzeiten für beide Seiten ein Gewinn. Denn angesichts des demographischen Wandels und neuen Qualifikationen wird die Ressource Mensch immer ein knappes Gut bleiben.