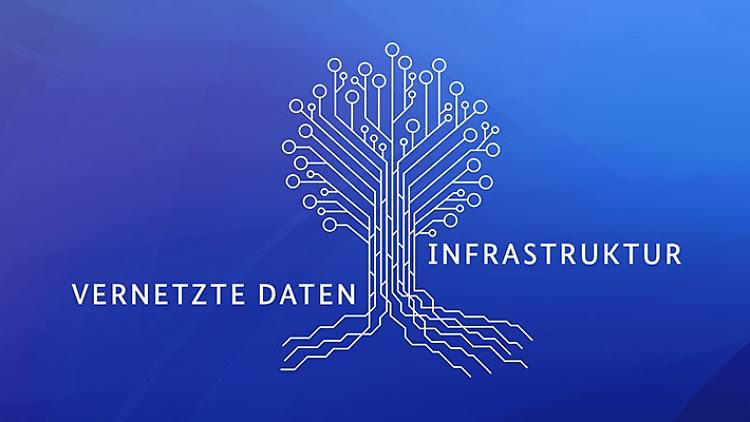„Spare in der Not – da hast du Zeit“, lautet eine durchaus zutreffende Verballhornung einer alten Volksweisheit. Das Original – „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“ – hat jetzt noch einmal Bundeskanzlerin Angela Merkel hervorgehoben, als sie in ihrer Sommer-Pressekonferenz die Tatsache herausstellte, dass das lange Festhalten an der schwarzen Null im Bundeshaushalt auch die Voraussetzung dafür sei, in Corona-Zeiten Milliarden an Soforthilfen lockerzumachen. Allerdings gilt auch die witzig gemeinte Variante angesichts weiterer Milliarden für das Kurzarbeitergeld, das nicht nur verlängert, sondern auch erhöht wurde.
Denn das Kurzarbeitergeld wie auch andere Soforthilfen verführt Unternehmen dazu, am Status quo der alten analogen Geschäftsprozesse festzuhalten, statt die Zeit des Zwangsstillstands für staatlich geförderte Investitionen in innovative Technologien zu nutzen. Wann, wenn nicht jetzt hätten Unternehmen Gelegenheit, über den digitalen Wandel nachzudenken? Statt Mitarbeiter zum teilbezahlten Nichtstun zu verdonnern, könnten Qualifizierungsmaßnahmen in digitalem Denken alle voranbringen. Der Stillstand am Fließband könnte lange geplante Umbaumaßnahmen ermöglichen, der Stillstand im Büro den ewig hinausgezögerten Releasewechsel möglich machen. Statt also ein System zu schaffen, in dem die Mitarbeiter ihre Hände zwangsweise in den Schoß legen, sollte digitale Initiative durch Zuschüsse honoriert werden können. Vom Kurzarbeitergeld – das zeigen die letzten Monate – profitieren praktisch nur die Baumärkte. Das ist natürlich auch irgendwie ein Konjunkturprogramm.
Oder wäre das bereits der Sündenfall eines staatlichen Eingriffs in die Handlungsfreiheit, den wir in einer liberalen Welt nicht wollen? Aber das sind Shutdown, Social Distancing, Maskenpflicht und künftige Massen-Impfung gegen Corona doch auch. Und die wollen wir schließlich im liberalen Kampf gegen die Pandemie. Oder?
Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungs-Startups Civey im Auftrag des Verbands der Internetwirtschaft eco ist die Mehrheit der Bundesbürger der Ansicht, die Bundesregierung sollte nicht trotz, sondern gerade wegen der Corona-Krise der Digitalisierung mehr Aufmerksamkeit widmen. Nach Einschätzung der Bevölkerung sollte dazu auch ein Richtung und Wirkung vorgebendes Digitalministerium eingesetzt werden – eine Forderung, die auch aus der Wirtschaft schon seit Jahren formuliert wird. Allerdings bedeutet ein Digitalministerium aus Sicht der Gesellschaft nicht unbedingt mehr Dynamik in der digitalen Transformation, sondern möglicherweise mehr Vorsicht. – Das jedenfalls war bisher der klassische Reflex, wenn die Deutschen mit Daten und intelligenten Algorithmen konfrontiert werden.
Doch laut eco-Umfrage sehen die Deutschen diesmal klare Zukunftsperspektiven, die die Erfahrungen aus dem Corona-Shutdown wiederspiegeln. Der weitere Ausbau der digitalen Infrastruktur (67,8 Prozent), eine verbesserte (oder überhaupt erst zu schaffende) digitale Bildungs-Agenda (54 Prozent) sowie IT-Sicherheit und Datenschutz (46,5 Prozent) sind die meistgenannten Aufgaben. Außerdem sehen die Deutschen die digitale Transformation der Wirtschaft (27 Prozent), ein Recht auf Home Office (22,6 Prozent) sowie die Weiterentwicklung der Corona-Warn-App (19,9 Prozent) als wichtige digitalpolitische Maßnahmen an.
Allerdings schaffen auch die jüngsten Erfahrungen mit staatlichen Fördertöpfen nicht unbedingt Zuversicht. Nicht nur sind von den 25 Milliarden Euro Soforthilfen nicht einmal eine Milliarde bislang abgerufen worden – also weniger als vier Prozent. Auch von den bereits seit fünf Jahren bereitstehenden elf Milliarden Euro Fördergeld für den digitalen Breitbandausbau wurden laut Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen Mittel von 91 Kommunen bislang nicht einmal abgerufen, geschweige denn konkret verplant. Es wäre also tatsächlich interessant zu sehen, wie ein Corona-Fördertopf für die digitale Ertüchtigung der Wirtschaft angenommen würde, in dem zum Beispiel Kurzarbeitergeld an interne Qualifikationsmaßnahmen gekoppelt ist. Kurzarbeit und langfristige Planung muss ja kein Widerspruch sein, sondern vielleicht die beste Voraussetzung für ein schnelles Wiedererstarken der Wirtschaft.