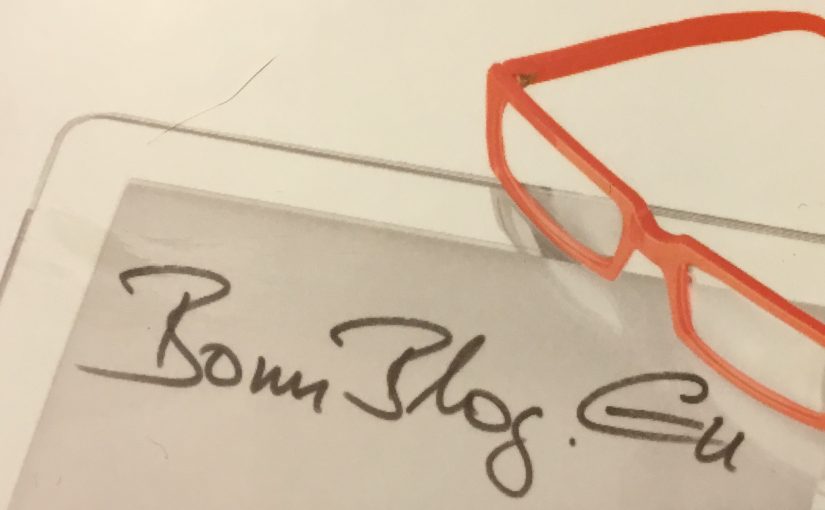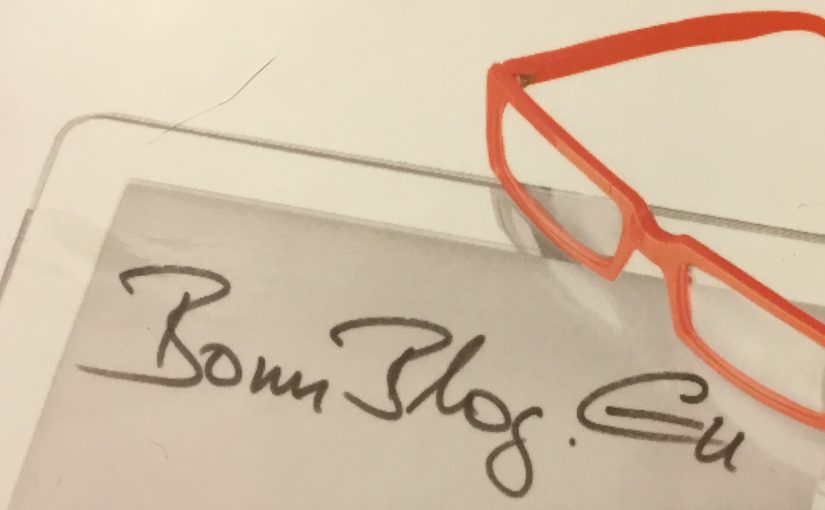Die Digitalisierung ist immer und überall! Sie betrifft alles und jeden. Weil sie überall greift und angreift, kann sich ihr niemand entziehen. Es gibt praktisch keinen Lebensbereich mehr, in dem man nicht irgendwie Stellung beziehen muss über das Ausmaß und die Wirkungsweise der Digitalisierung. Man konnte vor zwei Jahrhunderten völlig unbeeindruckt von der Dampfmaschine weiter leben, vor 100 Jahren auch ohne Elektrifizierung arbeiten, vor 50 Jahren auch ohne Großrechner erfolgreich sein oder vor 25 Jahren auch ohne das Internet am Weltgeschehen teilnehmen. Doch selbst wer heute auf Smartphone, Computer oder soziale Vernetzung verzichtet ist dennoch ein zumindest passiver Player in der digitalen Welt.
Wenn aber die Digitalisierung in die Zuständigkeit von jedem Einzelnen fällt, dann ergibt auch ein zentrales Ressort für die Digitalisierung keinen Sinn. Gerade weil die Digitalisierung Themen der inneren Sicherheit und juristische Implikationen nach sich zieht, weil sie einen Infrastrukturausbau verlangt und unser wirtschaftliches Gefüge berührt, gibt es in der jetzigen Bundesregierung gleich vier Ministerien, in denen die Digitalisierung beheimatet ist. Und eigentlich sollten es sogar viel mehr sein: die Veränderungen in der Arbeitswelt betreffen das Ministerium für Arbeit und Soziales, die geforderte Bildungsoffensive das Bildungsministerium, die Digitalisierung des Gesundheitswesens das Gesundheitsministerium und nicht zuletzt sind das Außen- und Verteidigungsministerium mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Außenbeziehungen befasst. Wie auch immer die neue Bundesregierung aussehen wird – die Digitalisierungsbranche bekommt es mit immer mehr Ansprechpartnern zu tun. Kein Wunder also, dass beispielsweise der IT-Verband Bitkom sich einen zentralen Ansprechpartner in der Politik wünscht und deshalb ein Digitalisierungsministerium fordert.
Aber ist der Bitkom, der sich selbst auch gerne als Hightech- oder Digitalverband titulieren lässt, denn noch selbst der alleinige oder zumindest dominierende Fürsprecher der Digitalisierungsbestrebungen? Anders als bei der Computerisierung geht die Digitalisierung heute nicht von einer Gruppe von Anbietern aus, sondern von den Anwendern, die überhaupt erst einmal eine Digitalstrategie mit Blick auf ihre Branche und ihre Geschäftsmodelle entwickeln müssen, ehe sie an die Umsetzung gehen können. So beschäftigen Versicherungen mehr Softwareentwickler als die meisten Softwarehäuser, weil ihr Produkt ganz wesentlich auf Berechnungsverfahren für Risiken und Margen beruht. Ein Maschinenbauer reichert sein Produkt durch Steuerungen und Sensoren an, ein Automobilbauer seine Modelle durch Fahrassistenzsysteme und Infotainment-Anlagen. Und auch die Gesundheitsdienstleister optimieren ihren Service durch elektronische Patientenakten, verbesserte Kommunikation und Big Data-Analysen. Und umgekehrt sind viele Startups von heute gar nicht so sehr mit der Entwicklung von Software befasst, als vielmehr mit der Digitalisierung und Umwälzung eines Geschäftsprozesses. Und so verwischt die Grenze zwischen Anbietern und Anwendern von Informationstechnik in dem Maße, in dem Software, Chips und Netz Bestandteil des Produktangebots werden. Jede Organisation, jede Branche ist ihr eigener digitaler Mittelpunkt, ihr eigener „Digital Hub“.
Ein Digitalverband mit Alleinvertretungsanspruch müsste also über das klassische Kastendenken hinausgehen und jeden digitalen Player in seine Reihen aufnehmen und in seine Lobbyarbeit einbeziehen. Das wäre das Ende des Spartenverbands und der Beginn eines „Bundesverbands der digitalen Industrie“. Aber den BDI gibt es schon. Er muss nicht noch einmal erfunden werden. Und es gibt auch die Digital Hubs schon, die auf Initiative des Bitkom auf dem Digital-Gipfel beschlossen und inzwischen an zahlreichen Standorten mit Branchenschwerpunkten umgesetzt worden sind. Unter der Führung eines Digitalverbands sind die Digital Hubs der Lösungsweg für eine generelle Vertretung digitaler Interessen, weil sie die vertikale Branchenausrichtung mit der horizontalen Sicht auf die Querschnittstechnologie Digitalisierung verbinden.
Das alles wird der neue Bitkom-Präsident Achim Berg in seiner Dokumentenmappe vorfinden, wenn er jetzt eine Woche nach seiner Wahl die Arbeit aufnimmt. Er muss das Profil des Verbands schärfen und gleichzeitig über die ganze Bandbreite der Digitalisierung ausweiten, ohne es aufzuweichen. Und da ist es durchaus ein Glücksfall, dass mit Achim Berg ein Mann an der Spitze des Bitkom steht, der mehrfach Schreibtisch, Branche und damit Perspektive gewechselt hat: von der Bürokommunikation über Telekommunikation zur Software und schließlich über die Dienstleistung zu Private Equity.
Dabei ist es auffällig, dass diese Selbstfindung im Bitkom durch die Repositionierung der CeBIT gespiegelt wird. Auch in Hannover gilt es, das Profil der Sparten-Messe für „Bürokommunikation, Informationsverarbeitung und Telekommunikation“ – dafür stand das CeBIT-Kürzel schließlich einmal – gegenüber der Industrie-Messe zu behaupten. Denn auch dort zeigt sich, dass die Digitalisierung das klassische Kastendenken aufgehoben hat und in jeder Halle und in jedem Außengelände zu besichtigen ist.
So lösen sich unter der Digitalisierung auch die klassischen Verbands-Kasten auf: die Automobilhersteller im VDA, die Maschinenbauer im VDMA, die Elektroniker im ZVEI, die Mittelständler im BVMW oder die eCommerce-Treibenden im eco und die Startups im BVDS – sie alle „machen in Digitalisierung“. So vielfältig die Ressortzuteilung in der Bundesregierung, so variantenreich ist die Interessensvertretung in den Verbänden. Ein Digitalverband muss die Partikularinteressen der einzelnen Verbands-Kasten bündeln, kanalisieren und steuern. Da wartet ein Berg an Arbeit.