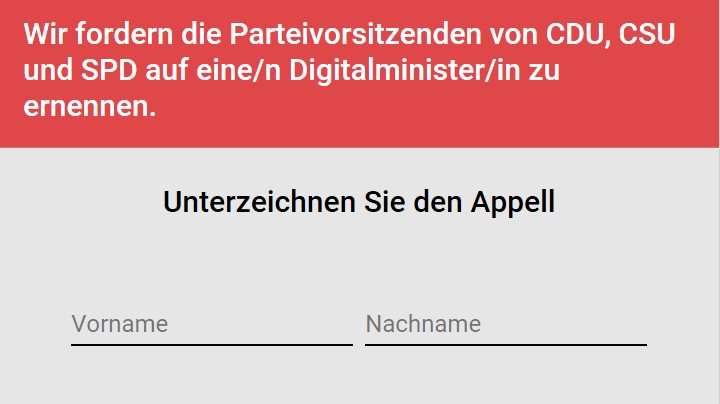Wozu braucht man eigentlich heute noch ein Betriebssystem?
Für alle, die nicht wissen, was ein Betriebssystem – englisch: Operating System, oder kurz: OS – ist: Es ist das Ding, das einen alle paar Wochen auf dem Smartphone daran erinnert, dass eine neue Version existiert, die man downloaden soll. Für diejenigen, die heute noch an ihrem Desktop kleben, lautet die Erklärung freilich anders: Es ist das Ding, dass knapp fünf Minuten benötigt, um den Personal Computer zu starten und dann aber alle die wunderbaren Anwendungen ausführt, die auf Win32 basieren – also Spiele, Multimedia, veraltete Office-Anwendungen, ERP-Clients… solche Sachen.
Aber Desktop-User sind eine aussterbende Rasse. Immer mehr Menschen nutzen Notebooks, Tablets, Smartphones. Rein rechnerisch kommen bereits zwei mobile Geräte auf jeden Deutschen. In Schwellenländern, in denen das größte Wachstum an IT-Endgeräten zu verzeichnen ist, spielen Desktops kaum noch eine Rolle. Mobile is the name of the game.
Und in mobilen Geräten dient das Betriebssystem eigentlich nur noch dazu, einen Browser zu starten, in dem dann die eigentlichen Anwendungswelten entfaltet werden: eine App für Facebook, eine App fürs Navigieren, eine App für Mails, eine App für Fitness – ach ja, und eine App fürs Telefonieren.
Auf diese Welten sind die Betriebssysteme Android und iOS optimal ausgelegt. Windows hingegen ist – auch in der Version Windows 10 – im Kern immer noch ein Betriebssystem für den Fat Client, für den Desktop PC, der zur Not auch ohne Server im Hintergrund seine Arbeitslast aufnimmt. Dieser Blog übrigens entsteht an einem Fat Client. Aber alles – von der Recherche über das Verfassen bis zur Veröffentlichung – könnte auch von einem mobilen Endgerät aus geschehen. Immer mehr Geschäftsprozesse lassen sich wunderbar von diesen Thin Clients aus erledigen. Mit modernen Benutzeroberflächen bekommen selbst globale Unternehmenslösungen einen Thin Client auf dem Smartphone oder Tablet. Die Zeiten ändern sich und unsere Endgeräte mit ihnen.
Das ist Microsofts Achillesferse. Windows – auch Windows 10 – ist vom Desktop her gedacht, nicht vom mobilen Endgerät. Windows 10 S ist der erste Versuch, eine abgestrippte Version fürs Mobile anzubieten. Aber sie kommt nicht allzu gut an. Sie ist kein „Mobile Native“ wie Android, sondern höchstens ein „Mobile Immigrant“.
Deshalb verdichten sich Gerüchte, wonach Microsoft seit Monaten unter dem Codenamen „Andromeda“ an einem nativen Betriebssystem fürs Mobile arbeitet, das zugleich mit einem – neuen – Betriebssystem für den Desktop (Codename „Polaris“) kooperiert. Für Microsofts Weltbild sind die beiden Codenamen geradezu sinnstiftend: auf der einen Seite der Nordstern, auf den die bisherige Navigation ausgerichtet war, auf der anderen Seite die Nachbar-Galaxie – eine fremde Welt. Dabei gibt es schon länger Gerüchte um einen Android-Look-alike von Microsoft. Dass Andromeda zumindest die ersten beiden Silben mit Android gemeinsam hat, dürfte durchaus als Hinweis gewertet werden.
Beiden gemeinsam ist Windows Core OS, der kleinste gemeinsame Nenner aller Betriebssystem-Varianten, die Microsoft derzeit auf dem Schirm hat. Neben Andromeda und Polaris sollen dies „Aruba“ für den Surface Hub und Oasis für „Mixed Reality“-Geräte sein. Sie sollen ab 2019 die Plattformen bilden, auf denen Microsoft die eigenen System- und Software-Welten gründet. Eine Betriebssystem-Plattform für alle IT-Welten vom Fat Client bis zum Thin Client in der Cloud – das ist der fehlende Schlussstein in Microsofts „Intelligent Cloud, Intelligent Edge“-Strategie.
Mit Polaris dürfte Microsoft auch auf Google Chrome OS zielen, das zwar bisher nur marginale Marktanteile erobern konnte. Aber gerade in Schulen ist Google mit kostengünstigen Chromebooks erfolgreich. Mit den Schwellenländern in Asien und Afrika entsteht zudem ein gigantischer Markt für einfache Endgeräte, die in der Fläche schnell einsatzbereit sind. Das ist ein Markt, den Microsoft nicht vernachlässigen darf, wenn es seine Plattform-Dominanz erhalten will. Denn zugleich gilt: jeder Windows-User ist ein Kandidat für die Cloud Plattform Azure. Und hier hat Microsoft in den letzten Monaten einen Aufstieg erlebt, der zu Lasten anderer Cloud-Anbieter – allen voran Amazon – geht. Es gilt, dieses Business von unten her abzusichern – mit nicht mehr ganz so fetten Clients auf dem Desktop und nicht mehr ganz so dünnen Clients auf dem Smartphone. Das ist des Googles Kern.