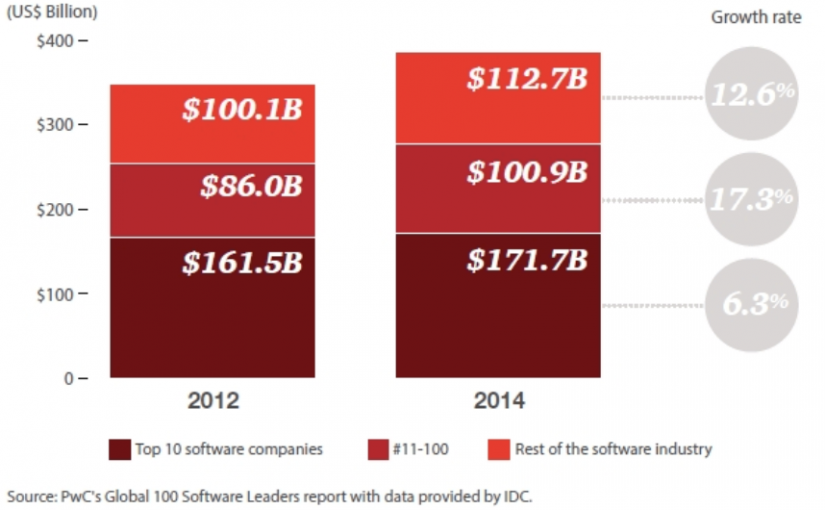Die Welle ist die Metapher der ersten Wahl, wenn es darum geht, einen Vorgang zu beschreiben, bei dem eine Veränderung erkennbar, unaufhaltsam und mit aller Macht auf uns zukommt, wir aber nicht einmal ansatzweise wissen, wie die Welt aussehen wird, wenn die Welle vorbeigezogen ist.
Die natürliche Regung ist, auf die sich nahende Welle zu starren, sie in ihrer Mächtigkeit wachsen zu sehen und uns mit den Methoden, die wir kennen, zu wappnen: festen Stand suchen, irgendwo festhalten, etwas mehr Höhe gewinnen. Besser ist es zu lernen, auf und mit der Welle zu surfen, ohne dabei überrollt und in die Tiefe gerissen zu werden.
Eine solche Welle ist eindeutig disruptiv! Sie beendet das zuvor Dagewesene.
Mit der Versionsnummer „4.0“ besprechen wir schon seit einem guten halben Jahrzehnt die sich nahende Welle der Digitalisierung, die jeden Lebensbereich erfasst: Von A wie „Arbeit 4.0“ bis Z wie „Zusammenleben 4.0“ geht die Spannbreite. Die „4.0“ ist die massivste Welle, seit die Menschheit sich entschlossen hat, die Bäume zu verlassen. Es hat 2500 Jahre gedauert, bis unsere Vorfahren vom Ochsen zur Dampfmaschine als Antriebsmotor wechselten. Es dauerte ein Vierteljahrhundert, ehe sich aus dem WorldWideWeb die Digitale Transformation erhob. Und es wird vielleicht nur 25 Monate dauern, bis diese Digitalisierungswelle über uns hinweggezogen ist.
Wer als Unternehmer und Führungspersönlichkeit die anvertraute Kohorte durch den Ansturm leiten will, sollte vier Fragen kritisch betrachten:
- Wie könnte sich die Welle auf die eigene Branche auswirken?
- Welche Herausforderungen ergeben sich für die bisherigen Prozesse?
- Ist meine Organisation überhaupt auf Veränderungen vorbereitet?
- Wie kann man einen Change-Prozess verstetigen?
Wer sich diesen Fragen kritisch stellt, wird schnell erkennen: Die klassischen Top-Down-Methoden im Management sind für die Digitale Transformation ungeeignet. Delegation und Fortschrittskontrolle, Hierarchien und streng getrennte Zuständigkeiten, abgegrenzte Markt- und Produktverantwortung sind keine geeigneten Organisationsformen für eine digitalisierte und damit vernetzte Welt. Stattdessen werden Kollaboration aller Beteiligten über soziale Medien, transparente Leistungsbewertung über Methoden wie „Objectives and Key Results“ oder Methoden des agilen Projektmanagements wie etwa „Scrum“ gefordert.
Nach einer jüngsten Umfrage, die unter der Führung der Deutschen Gesellschaft für Personalführung durchgeführt wurde, sieht sowohl die Führungsriege als auch die Mitarbeiterschaft diese als „Digital Leadership“ zusammengefassten Kernkompetenzen als entscheidend für den Ritt auf der 4.0-Welle an. Allerdings liegen die Einschätzungen über die jeweils vorhandenen Kompetenzen weit auseinander. Während sich das Management – wen wundert´s? – selbst gute Noten gibt, sehen die Mitarbeiter die in die Digitalisierung transformierenden Fähigkeiten der Führungskräfte eher „sehr weit“ vom notwendigen Maß entfernt. Tatsächlich sagt rund die Hälfte der Befragten – Management und Mitarbeiter -, dass Digital Leadership im eigenen Unternehmen noch kein Thema sei. Und die Mehrheit der Befragten gestehen sogar ein, dass sie keine Ahnung haben, wie es zu einem Wechsel im Managementverhalten im Sinne einer Digital Leadership kommen könnte.
Schon vor einem Jahr hat das Beratungsunternehmen Deloitte in einer ähnlich angelegten Studie diese Defizite identifiziert und dabei die Frage erörtert, wer überhaupt im Unternehmen der geeignete Digital Leader, der Chief Digital Officer, sei. Die reflexartige Antwort lautet naturgemäß: der CEO. Doch, so geben die Autoren der Deloitte-Studie zu bedenken, zwar kennt der CEO Produkte, Märkte und Prozesse – aber der klassische Top-Down-Ansatz dürfte ungeeignet sein. Hilfe könnte aus dem Marketing kommen – doch zumindest im Mittelstand wird Marketing immer noch als Werbung minimalisiert. Sie könnte auch vom Leiter der Informationstechnik kommen – doch zumeist ist dem CIO an der Verfestigung des Status quo gelegen.
Was Not tut, ist eine Person von außen, die nichts mit den überkommenen Strukturen zu tun hat. Der Chief Digital Officer ist ein Alien. Aber er hat eine hervorragende, ihn allein auszeichnende Eigenschaft: Er weiß, wie man auf der vierten Welle surft…