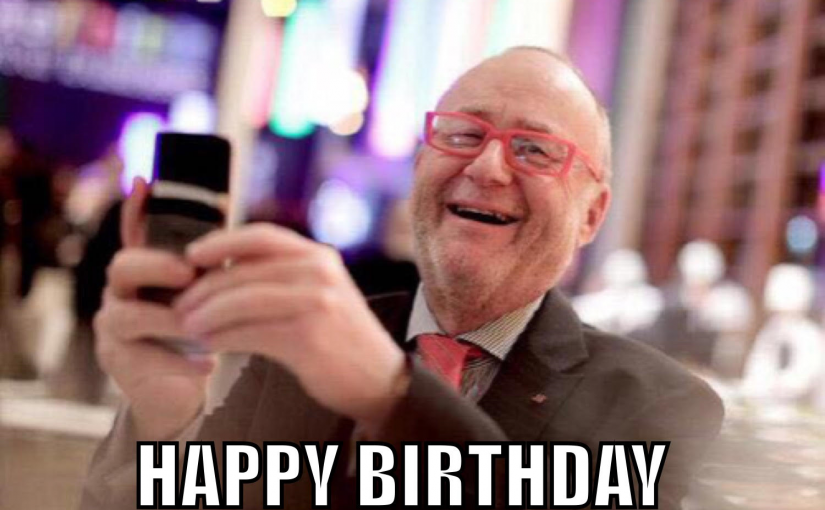Die Aussichten könnten besser kaum sein: mehr als die Hälfte der deutschen Anwenderunternehmen plant, das Budget im kommenden Jahr mit Blick auf den digitalen Wandel aufzustocken. Und immerhin jeder dritte will die Ausgaben wenigstens auf der bisherigen Höhe belassen. Das klingt schon deshalb ermutigend, weil die meisten Unternehmen in Investitionen in das Cloud Computing immer noch und vor allem Kostensenkungsmaßnahmen erkennen. Dass Cloud Computing sich aber inzwischen vom reinen Outsourcing-Modell zur hybriden Architektur für Mehrwert-Dienste wie Big Data, Künstliche Intelligenz oder mobile Computing entwickelt, bricht sich erst allmählich in den Köpfen der Anwender Bahn.
Dort herrschen vielmehr „beängstigende Verständnislücken“, wie sie jetzt der internationale Lösungsanbieter Epicor in einer groß angelegten Studie beobachtet hat. Immerhin eine von drei Führungskräften in Deutschland hat nach eigenem Bekunden zwar schon etwas von „Big Data“ oder „Cloud“ beziehungsweise „Software as a Service“ gehört, verbindet mit den Begriffen aber keine konkrete Vorstellung. Darüber hinaus gaben 36 Prozent zu, dass sie nicht mit dem „Internet of Things“ vertraut sind, für „3D-Druck“ liegt dieser Wert bei 44 Prozent, bei „Machine Learning“ bei 40 Prozent.
Der Wettlauf in die Digitalisierung scheint tatsächlich viele Anwender zu überfordern. Es geht nicht allein darum, auf der Höhe der technischen Entwicklung zu bleiben. Ebenso wichtig – wenn nicht wichtiger – ist es, die Möglichkeiten, die diese Technologien bieten, auch intern zu kommunizieren. Denn schließlich geht es darum, mit Hilfe von Big Data, KI, IoT, 3D-Druck oder Machine Learning die eigene Strategie so auszugestalten, dass man als Anwender einen größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann. Tatsächlich aber, so hat die Unternehmensberatung Kienbaum jetzt in einer groß angelegten Studie erfahren, hat eine von vier Führungskräften in Deutschland keine Klarheit über die aktuellen und zukünftigen Unternehmensziele. Ja, sogar jeder fünfte Manager mit Personalverantwortung tappt diesbezüglich im Dunkeln.
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge ändern, war vielleicht noch nie so hoch wie heute. Und die Veränderungen sind wohl auch noch nie so weitreichend gewesen – sieht man vielleicht von der Beherrschbarkeit des Feuers ab.
Und während viele Anwender diese Entwicklung damit abzutun scheinen, dass es sich bei der digitalen Transformation um eine Nebenwirkung der digitalen Giganten wie Google, Apple und Amazon handelt, die mit der eigenen Zukunft nur wenig zu tun hat, sind es in Wahrheit doch die Betreiber der Unternehmens-Architekturen – also Microsoft, IBM, Oracle oder SAP – die auf dem Weg ins Cloud Computing mit Hochgeschwindigkeit voranschreiten und gestern Big Data, heute IoT und morgen künstliche Intelligenz promoten. Da kann es nicht verwundern, dass manch mittelständischer Anwender angesichts technologischer Höchstgeschwindigkeit, mangelnder interner Kommunikation und dem Fehlen einer verlässlichen Vision auf der Strecke bleibt.
Da kann nur ein professioneller Erklärbär des Vertrauens helfen – und der ist im Grunde auch schnell bei der Hand. Die wenigsten mittelständischen Anwender kaufen direkt bei einem der großen Architektur-Anbieter. Sie arbeiten eher mit dem Systemhaus um die Ecke zusammen, das in etwa die gleichen Strukturen aufweist, den gleichen Menschenschlag herangebildet hat und offen zugibt, ebenfalls nur mit hängender Zunge mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten. 82 Prozent der ITK-Anbieter blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. Sie erkennen allmählich, dass Cloud Computing und die damit verbundenen Technologien einen Riesenmarkt für sie darstellen.
Microsoft zum Beispiel rechnet vor, dass 90 Prozent des eigenen Umsatzes durch Partner stimuliert ist. Und umgekehrt bedeutet jeder Euro Umsatz bei Microsoft ein Vielfaches an Einnahmen bei den Partnern. Das gilt ganz analog bei IBM, Oracle und SAP, die diese Zahlen nicht so dezidiert offenlegen, aber im Prinzip die gleiche Channel-Strategie fahren.
Und dieser Vertriebskanal befindet sich selbst im Umbruch. Es geht nicht mehr darum, goldene DVDs in den Firmenrechner zu stecken, um das nächste Update zu „deployen“. Es geht darum, aus den vielen Technologie-Optionen die richtigen für das Anwenderunternehmen auszuwählen, bei der Formulierung einer langfristigen Digitalstrategie zu helfen und diese Maßnahmen dann Schritt für Schritt umzusetzen. Dazu muss man die Zukunft erklären können. Und Voraussetzung dafür wiederum ist es, die technologische Zukunft auch zu verstehen.
Hier steckt wiederum die große Herausforderung für die Architektur-Anbieter. Sie müssen ihre Partner „enablen“, diese neue Rolle des Erklärbärs auch richtig auszuspielen. Ihre Aufgabe muss es sein, die „beängstigenden Verständnislücken“ zu schließen – ehe morgen neue aufbrechen.