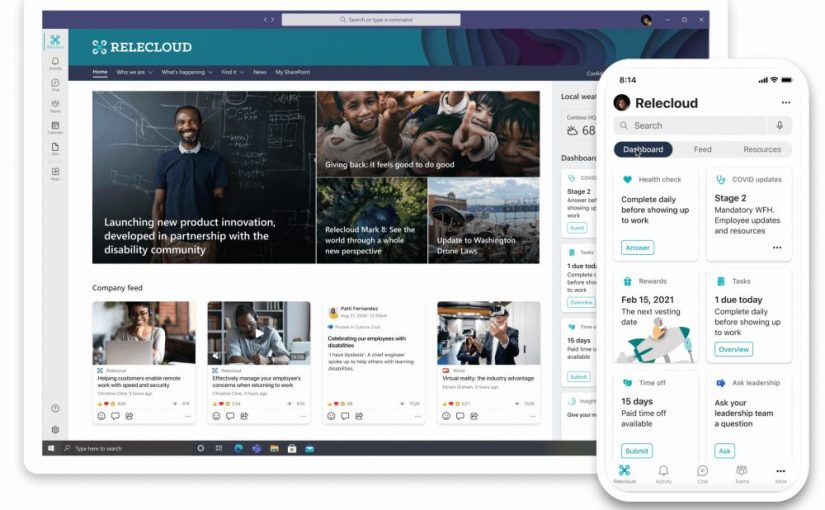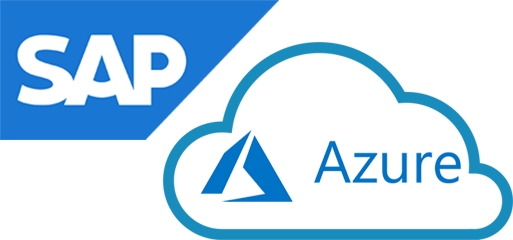Ich nehme jetzt mal meine (sprachliche) Maske herunter und sage wie es ist, beziehungsweise wie es wird: 2021 wird nicht das Jahr, in dem wir das Virus besiegen, sondern in dem wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben.
Denn, Hand aufs Herz, die Vermutung, jetzt noch ein bisschen Lockdown, die Inzidenz bei 35 einpendeln und der „Kaas isch geveschpert“, wie der Schwabe sagen würde – das ist eine Hoffnung, die wir getrost fahren lassen können. Es wird noch lange alles Käse sein.
Die Frage ist, wie wir uns auf diesen Käse einstellen. Noch mehr Lockdown, noch mehr wirtschaftlicher Stilltand, noch mehr Existenzkrise, noch mehr soziale Distanz, noch weniger kultureller Austausch – das soziale Tier „Homo Ludens“ wird daran noch stärker erkranken als an dem Virus. Die soziale Verdumpfung und wirtschaftliche Schrumpfung werden uns mehr in Mitleidenschaft ziehen und nachhaltigere Folgen haben. Und gegen diese Krankheit gibt es keinen Impfstoff. Für den Einzelhandel, um ihn exemplarisch aus der großen Menge der Virus-Kolateralschäden herauszugreifen, gibt es nur einen Impfstoff – und der heißt zahlungswillige Kunden.
Wir müssen schlauer sein als das Virus, wie es der Grüne Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock, Claus Ruhe Madsen, bei Maybrit Illner formulierte. Das gilt für jeden von uns. Das Geschäftsmodell des Einzelhandels besteht ja nicht darin, einen Laden in der Fußgängerzone zu unterhalten, sondern den Kunden ein Verkaufserlebnis zu bieten. Das Ladenlokal ist dabei nicht eine Ultima Ratio, sondern das gängige Geschäftsmodell der Nachkriegsära, das nun schon ein Dreivierteljahrhundert andauert. „Come in and find out“ – da hat sich einiges festgefahren. Aber der Handel lebt nicht vom Laden, sondern vom Handeln. Es gibt genug Beispiele, wie in einer digitalen Welt Konsumgüter verkauft, Essen ausgeliefert und Kulturgut offeriert werden können. Dabei ist die Ladenschließung noch nicht einmal eine zielführende Maßnahme gegen die Pandemie, wie sich immer deutlicher zeigt.
Nach dem Virus wird nicht „wie vor dem Virus“ sein. Wenn wir etwas gelernt haben sollten, dann das: Nach dem Virus ist „wie vor dem nächsten Virus“. Die Mutanten – übrigens in Gestalt der Pest einer der apokalyptischen Reiter – lehren uns gerade auf gruselige und hoffentlich nicht auch noch auf grausame Weise, dass wir es mit einer vielköpfigen Hydra zu tun haben.
Das Virus war schon einmal schlauer als wir. Die mit mangelhafter Genauigkeit „Spanische Grippe“ genannte Pandemie vor etwas mehr als 100 Jahren hat sich die Truppenbewegungen der Amerikaner, Franzosen, Engländer und der Deutschen im Ersten Weltkrieg zunutze gemacht. Ohne Anhängern der Dolchstoßlegende das Wort reden zu wollen: das damalige Influenza-Virus hat wohlmöglich den Ausgang des Ersten Weltkriegs stärker beeinflusst als alle militärischen Strategien und Rüstungsanstrengungen. Je nach Schätzung sind damals drei- bis viermal so viele Menschen dem Virus erlegen wie dem militärischen Weltenbrand.
Aber damals wusste man noch nicht, was ein Bazillus ist, geschweige denn, welche Gefahr durch Viren entsteht. Heute wissen wir das und reagieren in den westlichen Ländern wie das Kaninchen vor der Schlange. Wir verharren in Schreckstarre und nennen es Lockdown. Und wir verhalten uns geradezu antiwissenschaftlich: die Hot Spots sind in Alten- und Pflegeheimen sowie im häuslichen Umfeld zu suchen. Sie sind nicht zu finden in den Schulen, den Sportarenen, in den Läden und Restaurants, in den Kinos und Kunstpalästen – vorausgesetzt, sie befolgen die einschlägigen Hygiene- und Abstandsvorschriften. Warum hindern wir den deutschen Mittelstand daran, zu beweisen, dass er schlauer ist als das Virus?
Niemand hat das in der letzten Zeit besser argumentiert als der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, der seinen ersten Fernsehauftritt bei Markus Lanz hatte. Für sein Mantra – „Wir müssen schlauer sein als das Virus“ – hat er eigene Vorschläge, die übrigens nicht nur zeigen, dass er die Pandemie verstanden hat, sondern auch den digitalen Wandel. Statt eine wirkungslose App zu entwickeln, appelliert er an den gesunden Menschenverstand: Wenn es in unser aller Interesse ist, unseren Aufenthaltsort bekanntzugeben, dafür aber hingehen zu dürfen, wohin wir wollen, warum sollten wir das nicht tun. Stattdessen pochen wir auf den Datenschutz, der uns vor Daten schützt und damit vor der Erkenntnis, wie wir das Virus besiegen. Oder wie es OB Madsen sinngemäß formuliert: Statt eine Person im Gesundheitsamt hundert Daten erfassen zu lassen, bitten wir besser hundert Personen, ihre Bewegungsdaten selbst zu erfassen. – Ach, so einfach ist das? Ja. So einfach ist das. Denn Menschen haben persönliche Daten schon für weniger preisgegeben.
Wir müssten schlauer sein als das Virus. Aber sind wir es auch? Der Preis für „Survival of the Fittest“ geht nach der Hinrunde an das Virus. Die Menschheit muss sich schon ordentlich steigern, wenn sie in der Rückrunde noch gewinnen will. Zunächst aber würde es reichen, die große Koalition würde hier mit gutem Beispiel vorangehen und schlauer als das Virus sein.