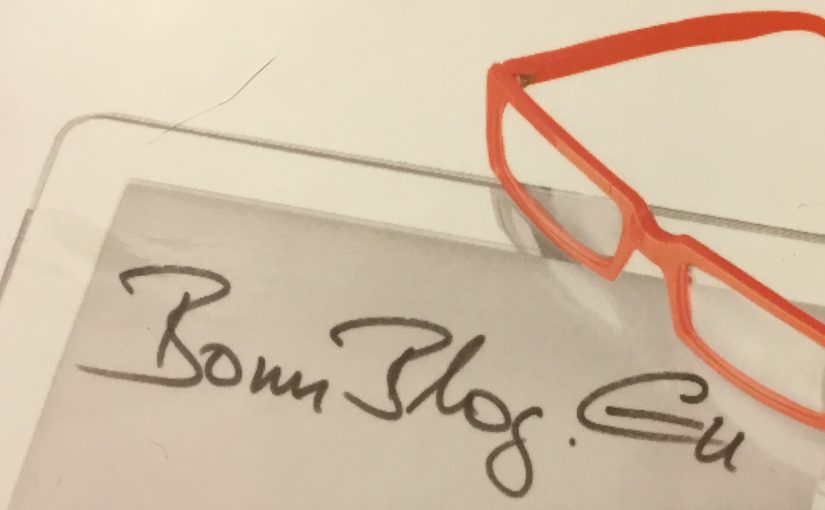„Und ob ich schon wanderte im finsteren (Digi)Tal, fürchte ich kein Unglück.“ Es scheint, als sollte die Zeile aus dem 23. Psalm zu Beginn des Digital-Gipfels der Bundesregierung stehen. Denn zum Auftakt des ab morgen stattfindenden Spitzentreffens hagelt es mal wieder schlechte Umfragewerte – nicht für Politiker, sondern für die Deutschen im Allgemeinen.
Das schlechteste Zeugnis haben sie sich dabei selbst ausgestellt. Auf die Frage des Hightech-Verbands Bitkom nach der eigenen Digitalkompetenz haben sich die Deutschen über 14 ein mäßiges „ausreichend“ ausgestellt. Dabei sah die Rentnergeneration (ab 65 Jahre) sich „mangelhaft“ auf das Leben in Digitalien vorbereitet. Und selbst die jüngeren Jahrgänge (14-29 und 30-49) mochten ihre Kompetenzen lediglich als „befriedigend“ deuten.
Im Gegensatz zu früheren Meinungsäußerungen sind die Deutschen aber gegenüber der Informationstechnik nicht mehr rundweg ablehnend – es ist also ein weiter Weg seit der bundesweiten Verweigerung von Volksbefragungen und Internetzugängen. 77 Prozent der 14- bis 29jährigen gaben an, dass die Digitalisierung eine große Bedeutung in ihrem Leben hat. Bei den 20- bis 49jährigen ist dieser Zustimmungswert sogar noch höher: 82 Prozent. Aber drei von fünf Rentnern gaben an, dass die Digitalisierung keine Bedeutung für sie hat.
Das wächst sich aus – könnte man meinen. Doch das wäre nicht nur zynisch, sondern auch gefährlich. Denn die Diskrepanz zwischen Neigung und Kompetenz ist durchaus eklatant. Gerade weil die Digitalisierung eine so hohe Bedeutung in Gesellschaft, Wirtschaft und im Privatleben erreicht hat, sollte die Digitalkompetenz dringend ausgeweitet werden. Das beginnt in der Schule, wo der – wohlgemerkt: richtige – Umgang mit Computern und vernetzten Systemen schon früh nahegebracht werden sollte, setzt sich bei der Berufswahl und Berufsausbildung fort und schließt schließlich das berufliche Leben mit ein. Gerade bei mittelständischen Betrieben wird ja allgemein konstatiert, dass es an belastbaren Digitalstrategien fehlt.
Da ist es sinnvoll, wenn Bildungsministerin Johanna Wanka Milliarden in die Digitalausstattung der Schulen stecken und – als zweite Seite der Medaille – auch die Digitalkompetenz der Lehrer voranbringen will. Da ist es auch löblich, dass mit den Digital Hubs zwölf Standorte hervorgehoben werden, deren Kernkompetenz in „digital plus X“ – also beispielsweise Mobilität, Logistik oder Finanzwesen – weiter gestärkt werden sollen. In einer dieser Regionen mit ausgewiesener hohen Kompetenzdichte – der Region Rhein-Neckar im Länderdreieck Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg – soll nun auch der Digital-Gipfel als Nachfolge-Event des nationalen IT-Gipfels tagen.
Dort werden aber in echter deutscher grüblerischer Manier Themen diskutiert, deren Fragestellung schon bange machen muss: „Verschlafen wir die Digitalisierung?“, „Verfügen wir über die neuesten Technologien?“, „Verfügen wir über die entscheidenden Kompetenzen?“, „Gelingt der Sprung von der Innovation zu Wachstum und Beschäftigung?“
„Ja, ja, ja und nochmals ja“, möchte man den Diskutanten zurufen – darunter das halbe Bundeskabinett, die Ministerpräsidenten der drei gastgebenden Länder und jede Menge Unternehmens-Vorstände. „Fürchtet euch nicht!“ Und vor allem: „Lasst das Lamentieren.“ Die Deutschen sind besser als der Ruf, den sie sich selber geben.
Einem Briten würde es auch nach Brexit und Wahlchaos nie in den Sinn kommen, sich selbst mangelnder Kompetenzen zu bezichtigen. Ein US-Amerikaner wird auch jetzt immer noch den Toast ausgeben: „Right or wrong, my country!“ Und in Frankreich singen Schüler spontan die Marseillaise, wenn sie sich über den Ausgang der Präsidentschaftswahl dort erleichtert zeigen. Die Deutschen, so scheint es, kennen nur die beiden Extreme – Sack und Asche oder Großmannssucht. Nur einen realistischen Blick auf uns selbst – das kriegen wir nicht hin.
Dabei ist die richtige Einschätzung der Notwendigkeiten ohne Panikmache und ohne Größenwahn die Herausforderung, die der Digital-Gipfel meistern muss. Es gilt, die richtigen Weichen richtig zu stellen und nach der Bundestagswahl darauf aufzubauen. Vier Leistungen fordert Bitkom-Präsident Thorsten Dirks im Vorfeld des Gipfeltreffen: eine grundsätzliche Neuausrichtung unseres Bildungssystems, eine konstante Datenpolitik, Ökosysteme der digitalen Transformation und die leistungsfähigste Infrastruktur. Das klingt ein wenig abstrakt, ist aber im Kern durchaus richtig – wenngleich erst die konkrete Umsetzung zeigen wird, ob der eingeschlagene Weg zukunftsweisend ist.
Ein Beispiel: In der aktuellen Debatte wird die Bildungsfrage gern auf die Aussage verkürzt, dass nur der erfolgreich sein kann, der zu programmieren versteht. Das ist Unsinn. Code ist nur eine Disziplin – und vielleicht nicht einmal die entscheidende. Wichtiger noch scheinen mir die Fähigkeit zu sein, andere Menschen zu verstehen, Geschäftsideen zu entwickeln, technische und kulturelle Zusammenhänge zu begreifen und zu wissen, wie man im Wirtschaftsleben agiert. Das sind die Fähigkeiten, die vor der Gründung eines erfolgreichen Startups stehen. Wer weiß, was zu tun ist, findet auch Partner, die es tun. Dazu braucht man Kreativität, Mut und Verantwortungsbewusstsein. Deshalb: „Fürchtet Euch nicht!“