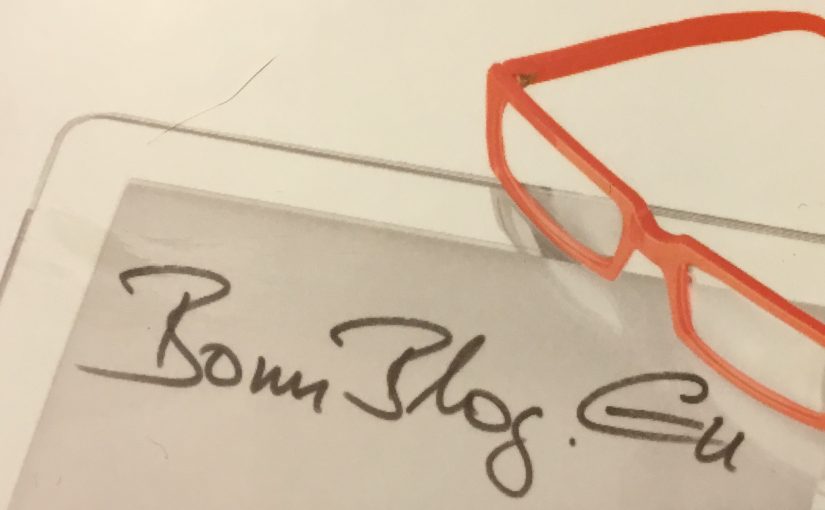In Zeiten zunehmender Digitalisierung gelten ERP-Lösungen als Old School. Enterprise Resource Planning – das war einmal revolutionär, als es darum ging, den Abteilungen das Silodenken auszutreiben und den Fluss der Werte im Unternehmen mit dem Fluss der Waren entlang der Supply Chain zu verknüpfen. Seitdem aber haben sich ERP-Systeme zumindest evolutionär weiterentwickelt: sie binden das Kundebeziehungsmanagement (CRM) mit ein, haben Financials und Controlling integriert und sind inzwischen sogar in der Lage, Office-Funktionen einschließlich eMail und Telefonie in den Geschäftsprozess zu übernehmen. Selbst wer den Begriff „Unternehmensressourcen“ weiter fasst als den klassischen Dreiklang von Maschinen, Material und Menschen (pardon! Falsche Reihenfolge, aber irgendwie doch richtig), wird mit ERP-Systemen glücklich. Sie managen Dienstleistungen und Projekte ebenso wie Verträge und Produktlebenszyklen.
Und doch hängt dem ERP-System als Genre etwas Altertümliches an. Hipp sind Webshops oder Big Data Analytics, hopp sind das Internet der Dinge und Social Media. Doch wenn man genau hinschaut, ist auch das nichts anderes als das Management von Unternehmensressourcen – wenn man den Begriff „Ressource“ eben nur weit genug fasst.
Aber genau darum geht es bei der Digitalisierung. Alles ist Ressource und am besten ist es, wenn diese Ressourcen in digitalisierter Form vorliegen. Dann nämlich können sie jederzeit und ohne Medienbrüche weiterverwertet werden. Das nennt man Fungibilität: Daten sind austauschbar – zwischen Funktionen, Geschäftsprozessen, Kooperationen, Märkten. Und sie lassen sich aggregieren und zu neuem Wissen zusammenfassen. Und genau das war und ist die Kernkompetenz von ERP-Systemen, So gesehen waren ERP-Systeme noch nie so modern wie heute.
Wenn sie nicht so alt wären! Das Hauptproblem lange tradierter ERP-Systeme ist ja gerade, dass sie mehrere Technologieschübe hinter sich haben und nach und nach zusätzliche Aufgaben übertragen bekommen haben. Man kann es kaum glauben: aber Software kann altern und verwittern. Viele monolithische ERP-Systeme, die heute den digitalen Fortschritt eher behindern als fördern, beweisen dies.
Das kann sich ändern, wenn man die Funktionen von ERP-Systemen aufbricht und als Services aus der Cloud bezieht. Nach einer jüngsten Marktuntersuchung von Forrester Research findet genau das statt. Dabei sind nicht unbedingt Lösungen gemeint, wie SAP sie vor einem Jahrzehnt mit Business by Design in den Markt gebracht hat. Damals hat SAP einfach ein weiteres monolithisches Software-Gebilde entwickelt, das sich von seinen Altvorderen nur dadurch unterschied, dass es auf einem Server irgendwo auf dem Globus residierte und nicht im firmeneigenen Hochsicherheitskeller.
Gemeint sind vielmehr hybride Software-Architekturen, in denen On-Premises-Lösungen mit zusätzlichen Funktionen – eben den Services – aus der Cloud integriert und zu neuen Lösungseinheiten zusammengefasst werden. Und es gibt eine Reihe von Kandidaten für diese Services, die ERP-Systeme zum nächsten Level der unternehmensweiten Ressourcenverwaltung und -verplanung bringen:
Office-Integration mit ERP ist heute noch keinesfalls selbstverständlich – wie sie beispielsweise bei Microsoft Dynamics365 und Office365 nahtlos funktioniert. Wer aber sein gut funktionierendes ERP-System nicht für eine Büro-Integration opfern möchte, kann heute Cloud-basierte Lösungen komfortabel einbinden.
Eine solche Two-Tier-Architektur bietet sich auch bei der Einbindung von Predictive Analytics auf der Basis von Big-Data-Tools an. Ebenso stehen heute bereits APIs für die Integration von KI-Anwendungen aus der Cloud bereit.
Interessant ist auch, dass Cloud-Ökosysteme nicht nur um die großen ERP-Lösungen von SAP, Microsoft und Oracle entstehen, sondern auch für den CRM-Spezialisten Salesforce zusätzliche Anwendungen auf der Basis der bereitgestellten Toolbox entstehen. FinancialForce und Kenandy sind beispielsweise Anbieter, die nach und nach auch in Europa bekannt werden.
Vor allem aber ergeben sich wesentliche Erweiterungen rund um das Internet der Dinge, mit denen ERP-Systeme weiter ausgebaut werden. Gerade die Zusammenfassung von Daten aus dem Fertigungsgeschehen in einem Manufacturing Execution System kann nur sinnvoll über die Cloud erfolgen. Das MES agiert dann wie ein Vorschalt-System, das die Daten erst einmal bündelt, da die ERP-Systeme nicht unbedingt für die schnelle Verarbeitung von Massendaten bekannt sind.
Digitalisierung ist eben auch die Digitalisierung der Unternehmensressourcen – oder zumindest der Information über die Ressourcen. Das ist die wesentliche Leistung der ERP-Systeme, seit es Materialbedarfsplanungen gibt.
Das ist zwar Old School, ist aber in Zeiten der Digitalisierung durchaus auch Gold School.
Kategorie: Oracle
Größe spielt keine Rolle
Was unterscheidet eigentlich ein Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern von einem Unternehmen mit mehr als 1000? Grundsätzlich doch eigentlich nichts – oder doch? Die Aufbauorganisation mag ein wenig komplexer sein: aus Referaten werden Abteilungen, aus Geschäftsführern Vorstände, aus Niederlassungen Landesgesellschaften. Aber die Art und Weise, wie sie ihre Branche definieren, ihre Kunden verstehen, ihre Geschäftsprozesse interpretieren und ihre Produkte entwickeln, ist unabhängig von der Firmengröße gleich.
Lange Zeit galt es aber unter IT-Anbietern als ausgemacht, dass die Komplexität einer Unternehmenslösung mit der Größe des Unternehmens zunehmen muss. Mittelstandsgerecht war demnach gleichbedeutend mit kompakt, Konzerngerecht bedeutete komplex. Small and Medium Companies waren immer knapp bei Kasse, Global Player hatten unerschöpfliche Budgets. Kein Wunder also, dass diese Weltsicht zu zwei völlig unterschiedlichen Vertriebsorganisationen führte: hier die Generalisten mit der Gold-DVD für jede Aufgabenstellung, dort die Spezialisten in einem Stab an Unternehmensberatern und IT-Experten. IBM, SAP, Oracle oder Microsoft – sie alle leisteten sich einen dualen Vertrieb, der – wie man so sagt – auf Augenhöhe mit dem Kunden kommunizieren sollte.
Der digitale Wandel scheint auch dieses Fundament des Software-Vertriebs aufzulösen: Nicht nur zeigt sich mehr und mehr, dass die Geschäftsprozesse in mittelständischen Unternehmen genau so komplex sein können wie in großen Konzernen. Sondern es zeigt sich auch, dass die Weiterentwicklung von IT-Strukturen und die Aktualisierung von Software und Systemen am besten über die Cloud funktioniert. Es ist höchstens noch eine Frage der Economies of Scale, ob 500 oder 1000 Arbeitsplätze aktualisiert werden sollen. Und es ist noch nicht einmal eine Frage der Größe, ob zusätzliche Cloud-Services neue Einsatzmöglichkeiten bieten. Eigentlich wussten wir es schon immer: Größe spielt keine Rolle.
Microsoft scheint diese Dichotomie aus Groß und Klein nun im Rahmen einer groß angelegten Reorganisation auflösen zu wollen, in dem die Trennung von SMB und Enterprise aufgelöst wird. Für mittelständische Kunden bedeutet das möglicherweise, dass der liebgewonnene Microsoft-Vertreter künftig nicht mehr zum Kaffee kommt. Umgekehrt soll die weitere Spezialisierung des Tele-Supports so viel individuelle technische Unterstützung bringen wie bei Konzernen. Auch Microsoft-Partner versprechen sich von der Reorganisation eine bessere Unterstützung im täglichen Geschäft. Denn auch die mittelständisch geprägten Softwarehäuser leiden darunter, dass im globalen Microsoft-Netz nicht immer und nicht sofort der nötige Sachverstand zu finden war. Ein neues Partnernetz soll hier die Ressourcen besser bündeln und durch Cloud-Services ergänzen.
Die von Satya Nadella eingeleitete Neuausrichtung unter dem Motto „Microsoft first, Cloud first“ bedeutet für rund 3000 Vertriebsmitarbeiter weltweit – und das bedeutet: außerhalb der USA – allerdings das Aus. Dass ihnen möglicherweise nach der Kündigung eine Neuanstellung mit allerdings befristetem Vertrag winkt, ist bedingt löblich. Sie werden sich als Opfer der Digitalisierung sehen müssen.
Aber diese Entwicklung war abzusehen: spätestens seit der wenig geglückten Markteinführung von Windows 7 noch unter Steve Ballmer weiß Microsoft, dass es immer schwieriger wird, mit klassischen Methoden neue Software in weit verzweigten Organisationen einzuspielen. Die Deployment-Kosten überstiegen die Lizenzgebühren um ein Vielfaches. Das war die Ultima Ratio für den Weg in die Cloud.
Jetzt übernimmt die Cloud aber neben den Infrastruktur-Leistungen auch mehr und mehr die Aufgabe, zusätzliche Softwareangebote als Services zu einer bestehenden Unternehmenslösung zu ergänzen. Vor allem rund um Anwendungen der künstlichen Intelligenz und der Big Data-Analyse baut Microsoft sein Software-Portfolio aus der Cloud über Partner kontinuierlich aus. Darauf muss sich der Vertrieb bei Partnern und bei Microsoft selbst einstellen. Profitieren sollen davon aber Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen. Und das ist gerade für den deutschen Mittelstand eine gute Nachricht. Denn in der bislang vernachlässigten Größenklasse zwischen 500 und 1000 Mitarbeitern gibt es Hunderttausende von erfolgreichen Firmen. Größe spielt eben wirklich keine Rolle mehr in der Cloud.
Software-Szene als Ökosystem
Das jüngste DAX-Unternehmen wird dieses Jahr auch schon 45 Jahre alt: SAP. Die Walldorfer sind zugleich das einzige deutschstämmige Softwarehaus von Weltruhm – auf Augenhöhe mit den Riesen Microsoft, Apple, IBM oder Oracle. Hierzulande folgen die Software AG – mit einem Abstand so groß wie die Tabellenlücke zwischen 1899 Hoffenheim und Darmstadt 98 – und die Steuerberater-Genossenschaft DATEV. Selbst die für die Software-Entwicklung zuständigen Abteilungen der großen deutschen Automobilhersteller, Maschinenbauer, der Geldinstitute und Versicherungen sind in der Regel personell besser ausgestattet als der große Mittelstandsbauch der hiesigen Software-Szene.
Das sagt zweierlei über den Wirtschaftsstandort Deutschland: Zwar kommen die meisten Hidden Champions – also die viel zitierten heimlichen Marktführer – aus deutschen Landen, aber außer SAP ist im letzten halben Jahrhundert kein innovativer Weltkonzern entstanden. Und obwohl es in den siebziger und achtziger Jahren einen Boom der Software-Gründungen durch die mittlere Datentechnik und in den neunziger Jahren durch den Personal Computer und das Internet gab, hat es kaum einer der Software-Unternehmer zu mehr als regionaler Größe gebracht.
Warum eigentlich? Software braucht jeder Mensch und jede Organisation – vor allem in Deutschland, wo die Prozessoptimierung gerade durch den Einsatz von modernen Computeranwendungen zur Königsdisziplin aufgestiegen ist. Aber dieser Bedarf wird überwiegend von den Weltmarktführern mit ihren globalen Standardlösungen bedient – und von den laut Schätzungen rund 30.000 deutschen Softwareanbietern verfeinert, ergänzt oder überhaupt implementiert. 30.000 kleine und mittlere Unternehmen – das entspricht rund einem Prozent aller in Deutschland gemeldeten Unternehmen. Zum Vergleich: In den letzten Jahren entstanden rund 3000 digitale Startups – also ein Promille.
Das wird sich auch nicht ändern, wenn Software nun als Treiber des digitalen Wandels eine erneute und erneuerte Position als zentralen Wirkstoff für Fortschritt, Wachstum und Wertschöpfung erfährt. Denn der Umbau der Softwarelandschaft vollzieht sich im größten europäischen Software-Markt nur zögerlich:
- Noch halten deutsche Software-Unternehmer krampfhaft an alten Geschäftsmodellen fest, die auf Lizenzvertrieb, Software-Installation vor Ort und aufwändigen Beratungsleistungen beruhen – und zögern stattdessen mit dem Schritt ins Cloud Computing.
- Noch bevorzugen deutsche Software-Entwickler die traditionellen Entwicklungsmethoden, Test- und Implementierungsverfahren und wenden sich erst allmählich einer agilen Methodik zu, die der gestiegenen Geschwindigkeit von Innovation und Weiterentwicklung bei angemessener Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen würde.
- Noch verstehen vor allem mittelständische Software-Unternehmer ihr Ökosystem als verlängerte Werkbank der globalen Anbieter von Standard-Software, statt die Mechanismen einer teilenden Gesellschaft für den eigenen Software-Vertrieb zu nutzen, wie es die digitalen Startups tun.
Der Hightech-Verband Bitkom hat inzwischen die zentrale Rolle, die deutsche Software-Unternehmen bei der digitalen Erneuerung von Wirtschaft und Gesellschaft einnehmen könnten, zu einem Kernthema im Vorfeld der Bundestagswahl erhoben und den Urnengang im Herbst zu einer „Digitalwahl“ stilisiert. Dabei geht es dem Verband darum, für den soften Antriebsstrang der deutschen Wirtschaft neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Förderung der Software-Kompetenz bei Schülern und Auszubildenden gehört ebenso zu den politischen Maßnahmen, die der Bitkom vorschlägt, wie die Stärkung des Öffentlichen Sektors als Vorreiter der Digitalisierung, der zugleich durch offen gestaltete Ausschreibungen auch kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu staatlichen Aufträgen verschaffen soll. Und nicht zuletzt sollen offene Architekturen unter Nutzung offener Schnittstellen, Formate und Standards in gemeinsamen Projekten von Wissenschaft und Wirtschaft entstehen.
Das klingt nach Dirigismus und weniger nach dem freien Spiel der Kräfte, für das die digitale und soziale Marktwirtschaft stehen sollte. Und es klingt ein bisschen nach der Kampagne, die Ende der achtziger Jahre ein für alle zugängliches Betriebssystem als Basis für ein offenes Ökosystem hervorgebracht hat: Unix. Auch da waren es die Behörden und halbstaatlichen Organisationen, die sich vor den Karren einer vermeintlichen Offenheit spannen ließen. Herausgekommen ist dabei – nun immerhin das Internet als Basis für ein neues digitales Ökosystem. Es gibt bei aller Regulierung doch immer wieder Überraschungen!
Stoff für die Wolke
Im Markt für Business Software wird kräftig zugekauft: Microsoft ergänzt seine Dynamics Suite um LinkedIn, Oracle bereichert sich um NetSuite, und SalesForce – vor einem Jahr noch selbst sicherer Übernahmekandidat, wenn Microsoft nicht der angefragte Preis zu hoch gewesen wäre – übernimmt Demandware, die jüngste Kopfgeburt von Stefan Schambach. Da ist es gut, dass die Aktie von SAP derzeit beinahe auf dem 52-Wochen-Hoch notiert.
Denn hier wird mit Milliarden jongliert. Und kein Übernahmefall scheint übertrieben oder überteuert zu sein. LinkedIn ging für reichlich 28 Milliarden Dollar über den Tisch, NetSuite für immerhin gut 9 Milliarden Dollar und auch Schambachs Verkaufssoftware war Marc Benioff mehr als 2 Milliarden Dollar wert. Was alle diese Übernahmen gemeinsam haben: Sie sind allesamt Cloud-orientierte Zukäufe und sie erfolgten im friedlichen Einvernehmen. Ist denn die Zeit der feindlichen Übernahmeschlachten vorbei?
Wer heute im Business-Sektor keine Cloud-Offerte im Angebot hat, wird mit dem guten alten Standardsoftware-Modell nicht mehr lange glücklich sein. Dabei ist es ein Treppenwitz der Cloud-Geschichte, dass SAP mit Business by Design die ganze Branche erst wuschig gemacht hat und inzwischen hinter den wolkigen Angeboten der anderen hinterherrennen muss. Kein Wunder, dass SAP – nun offenbar einsichtig geworden – seinen Partnern völlig neue Profit-Angebote unterbreitet, damit nicht nur die eigene Lösung, sondern auch die zahllosen Partnerangebote in die Cloud kommen. Bis lang wollte SAP an den Partnern verdienen, jetzt sollen die Partner mit der SAP-Cloud Gewinne machen.
Aber reicht das? Es ist SAP selbst, das sich auf die Suche machen muss, um mächtige Partner für die Cloud zu gewinnen. SAP steht immer noch für Systeme-Anwendungen-Programme und nicht für „Service aus Portalen“. Trotz immenser eigener Investitionen – die freilich nicht immer zielführend waren – braucht SAP selbst Partner mit starker Präsenz in der Cloud, im Mobile Computing und in den sozialen Medien. Da erscheint die Deutsche Telekom als Partner der ersten Wahl. Immerhin haben die Bonner schon Microsoft aus der Cloudpatsche geholfen. Gerade der Weg zum individuellen Anwender und kleinen Unternehmen könnte über die Deutsche Telekom geebnet werden.
Als Partner in der Cloud bietet sich in Deutschland freilich auch die Datev an, deren Geschäftsmodell rund um Lösungen für den Mittelstand konzipiert ist und die zu den größten Cloud-Betreibern in Deutschland zählt. Eine für den Mittelstand zurecht geschneiderte SAP-Lösung in der Datev-Anwendungscloud würde mehr Stoff in die deutsche Wolke bringen.
Man muss sich ja nicht gleich gegenseitig übernehmen. Da würden sich ja doch alle etwas übernehmen. Aber es wäre ein guter Schutz vor einer Übernahme.