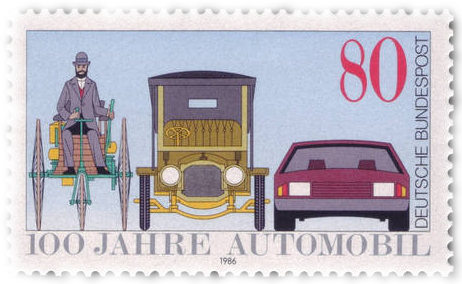Ein hinreichendes Niveau an Bildung hatten lange Zeit ja bekanntlich jene erreicht, die wussten, wo was steht. In unserer postmodernen, postfaktischen Zeit ist es hingegen vollkommen ausreichend, wenn Google weiß, wo was steht. Der jeweilige Bildungsstand ist folglich nicht mehr unbedingt human, sondern höchstens humanoid, wenn nicht sogar nur noch hybrid.
Bei der Integration von Unternehmensanwendungen scheint sich diese Tendenz auch durchzusetzen: zu Beginn der ERP-Ära gab es für Alles und Jedes dedizierte Anwendungen mit eigener Datenhaltung, die schließlich von allumfassenden Komplettsystemen abgelöst wurden, deren Versprechen die alles zusammenfassende Datenbasis war. Jetzt gehen mehr und mehr Unternehmen hin und kaufen Services aus der Cloud hinzu – und gefährden die eigene homogene Datenstruktur.
Die postmoderne – aber noch lange nicht postfaktische – Unternehmenslösung, die Services für Spezialanforderungen aus dem Web heraus ergänzt, verspricht mehr Agilität. Denn die monolithischen Strukturen der Großanwendungen lassen sich auch mit modernsten Entwicklertools nur noch sehr langsam und nach aufwendigen Integrationstests erweitern. Das hemmt so manche Innovation. Der Griff zu Cloud-Services liegt da nahe – vor allem dann, wenn die zusätzlichen Funktionen nur eine taktische und keine strategische Bedeutung haben, selten genutzt werden oder aber eine permanente Pflege durch Dritte erfordern – die komplexen Anforderungen bei der Zollabwicklung gehörten dazu oder neuerdings Big Data-Anwendungen für vorausschauende Analysen.
Doch das Mehr an Agilität wird möglicherweise durch ein Weniger an Datenkonsistenz erkauft. Am Ende könnten Abteilungen in Unternehmen zu unterschiedlichen Erkenntnissen und Aktionen kommen, weil sie nicht mehr auf eine identische, konsistente Datenbasis zurückgreifen. Dann ist die Frage, wo was steht, plötzlich doch wieder von zukunftsentscheidender Bedeutung.
Nach Ansicht der ERP-Analysten von IDC gehört die Wahrung der Datenintegrität in einer hybriden Umgebung zu den nächsten ganz großen Herausforderungen. Das Internet der Dinge mit seinen Milliarden Maschinendaten wird dieses Phänomen weiter verstärken. Denn die heutigen monolithischen ERP-Systeme können schlechterdings gar nicht schnell genug buchen, um diese Datenschwemme aufzunehmen. Viele ERP-Anbieter flüchten sich deshalb in Vorschaltsysteme – Digital Hubs oder Manufacturing Execution Systems -, mit denen die Datenflut abgefangen und erst als aggregierte Erkenntnisse weitergeleitet werden.
Was bisher nur für die Übernahme und Zusammenfassung von Maschinendaten gedacht ist, könnte aber zu einem zentralen Baustein postmoderner ERP-Systeme avancieren: Datensammler, die aus den Daten der hybriden Lösungen wieder homogene Informationsbasen schaffen. Sie könnten einer der ersten Bausteine eines zukünftigen ERP-Systems sein, das IDC ein wenig hochtrabend „Intelligent ERP“ nennt – womit aber eben nicht intelligente Systeme gemeint sind, sondern solche, die wissen wo im Web und on Premises was steht.
Weitere Bausteine sind schon längst da. Predictive Analytics, mit denen aus den bestehenden Daten Aussagen über die zukünftige Entwicklung generiert werden können, gehören ebenfalls in das postmoderne ERP-Bestiarium. Und – wenn auch erst am Horizont zu erkennen – schließlich wird das Enterprise Resource Planning zum selbstlernenden System, das seine eigenen Algorithmen auf der Basis der gemachten Erfahrungen anzupassen in der Lage ist. Machine Learning ist bereits jetzt das ganz große Ding, wenn es darum geht, Roboter noch hilfreicher agieren zu lassen. Klassische Systeme entwickeln sich nicht mehr weiter, nachdem der letzte Programmierer das Interesse an ihnen verloren hat. Lernende Systeme aber erkennen Veränderungen und passen sich ihnen an.
Ist es nicht genau das, wovon ERP-Anwender seit über drei Jahrzehnten träumen? Das Marktumfeld verändert sich – das ERP-System auch. Nach diesem Geschäftsmodell erhalten sich Tausende von Softwarehäusern am Leben, die ihren Kunden die Anpassungen als teure Dienstleistung verkaufen. Sollte das etwa auch ein Geschäftsmodell sein, das vom Aussterben bedroht ist? Wo steht das denn?