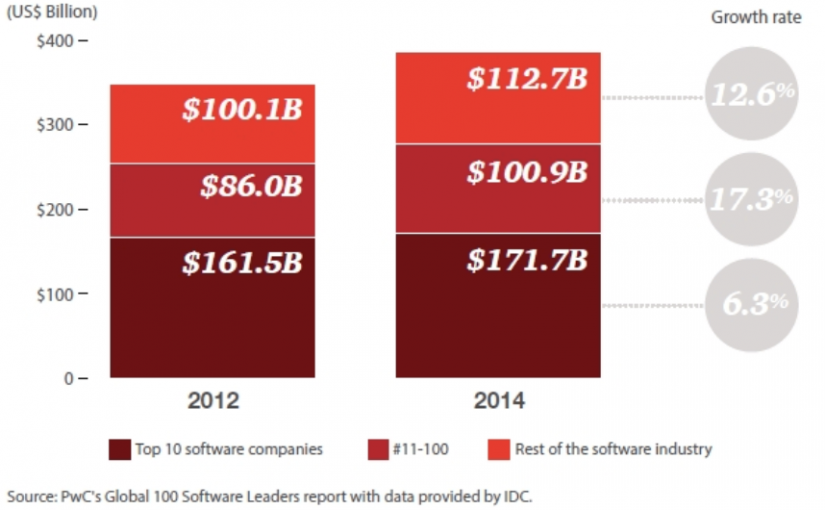Es ist gar nicht so einfach, jedes Jahr zehn neue Megatrends in der Informationswirtschaft zu identifizieren. So schnell entwickelt sich nicht einmal diese Branche vorwärts. Und: je komplexer Megatrends wie Internet der Dinge, Big Data oder Cloud Computing sind, desto langsamer erfolgt ihre Umsetzung – vor allem im Mittelstand.
Doch ohne die nächsten zehn ganz großen Dinger wäre die Gartner ITXpo im floridaischen Orlando nicht die Gartner ITXpo. Bemerkenswert ist jedoch dieses Mal, welcher Trend nicht zu den zehn ganz großen gehört: Cyber Security! Haben wir aufgegeben, uns zu schützen, weil Hacker Hekatomben verursachen können. Der Wahlkampf in den USA macht deutlich, dass nichts und niemand vor den Angriffen aus dem Alltag der Cyberkriminellen sicher zu sein scheint.
Dabei werden wir immer verwundbarer – wenn man die aktuellen Trends auf sich wirken lässt:
Trend #1: Dass Künstliche Intelligenz Maschinen dazu befähigen kann, aus dem Verhalten ihrer Umgebung zu lernen, ist eigentlich nichts Neues. Neu ist aber das Ausmaß, in dem künftig die uns umgebenden Geräte mit dieser Fähigkeit ausgestattet sein sollen. Dabei steckt die Lernfähigkeit nicht in der Maschine selbst, sondern irgendwo in der Cloud. Was ein Gerät lernt, könnten alle verbundenen Geräte nutzen.
Trend #2: Was für Geräte gilt, trifft auch – oder sogar noch eher – auf die Software zu. Schließlich ist es die Software, die Geräte zu lernenden Systemen macht. Aber wenn sich Apps oder virtuelle Assistenten auf unserem Smartphone künftig ebenfalls an unserem Verhalten orientieren, können wir sie besser für unsere Zwecke einsetzen. Oder sie uns?
Trend #3: Nicht direkt intelligent, aber ihrer Umwelt bewusst werden Gegenstände durch Sensoren und die Vernetzung mit anderen Dingen. Im Ergebnis können sich Gegenstände des täglichen Bedarfs koordiniert und scheinbar intelligent verhalten – zum Beispiel, indem sie Licht nur dort einschalten, wo auch Menschen sind, oder den Verkehr nur dort regeln, wo auch Verkehr zum Regeln vorhanden ist.
Trend #4: Virtuelle Realität wird heute vor allem mit Computerspielen in Verbindung gebracht. Dann gibt es noch die Bilder von Designern, die mit ihren 3D-Brillen vor einem Fahrzeugmodell stehen und etwas sehen, was wir nicht sehen. Zwar führt die erweiterte Realität (Augmented Reality) nicht unbedingt zur Bewusstseinserweiterung, aber vielleicht zu mehr Erkenntnis, wenn es durch diese Technik schneller und besser gelingt, durch große Datenmengen zu navigieren. Schon heute gilt, dass jede gute Grafik mehr Erkenntnis bringt als die Tabelle, auf deren Daten sie beruht.
Trend #5: Wer unter digitalen Doppelgängern die Suche nach einem zweiten Selbst versteht, liest zu viel Science Fiction. Tatsächlich aber erwartet Gartner, dass digitale Doppelgänger von Maschinen und Dingen besser dabei helfen können, Wartungsarbeiten zu planen oder Einsatzmöglichkeiten zu erweitern. Wenn der Daten-Doppelgänger voraussagen kann, wann ein Teil verschleißt, kann man die Maschine rechtzeitig ausbessern.
Trend #6: Blockchain, die manipulationssichere Basis für Kryptowährungen, tritt bereits einen Siegeszug unter Fintech-Apps und Banken-Services an. Doch, so mutmaßt Gartner, wenn sich das Verfahren weiterhin als vertrauenswürdig erweisen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass praktisch alle Finanzanwendungen darauf zurückgreifen. Dann gäbe es vielleicht sogar ein einziges cloud-basiertes Hauptbuch für Soll und Haben – wie beim Nikolaus…
Trend #7: Chatbots werden nicht nur als sprechende virtuelle Assistenten ihren Einsatz finden – sie sind sozusagen die Schnittstelle schlechthin, die Maschinen dazu befähigt, unsere Befehle zu verstehen und auszuführen. Die Zeiten wären endlich vorbei, in denen wir – wie es im Sprachgebrauch entlarvend heißt – „den Computer bedienen müssen“.
Trend #8: MASA – oder: Mesh App and Service Architecture – ist die Vorstellung, dass eine Vielzahl von Anwendungen eine Reihe von zentralen Basisdiensten nutzt – beispielsweise Sprachdienste oder die ultimative Art und Weise der Buchhaltung. Oder sie könnten einen gemeinsamen Datenpool nutzen – wie die Wissensbasis medizinischer Veröffentlichungen. So würden nicht nur Anwendungen schnell zusätzliche Funktionen übernehmen können – ihre Funktionsweise würde auch international standardisiert werden können.
Trend #9: Wer schon bei MASA an die Matrix oder den Sprawl denkt, der wird spätestens mit der „Digital Technology Platform“ an den großen, vereinheitlichten Cyberspace denken: alle künftigen Anwendungen und Dienste beruhen nach Ansicht der Gartner-Forscher auf praktisch ein und derselben Technologieplattform, die aus Informationssystem, Benutzer-Schnittstelle, Analyse- und Auswertungsfunktionen, dem Internet der Dinge und dem Branchen-Ökosystem besteht.
Trend #10: Und dann doch noch Sicherheit: zu den Basisdiensten, die diese vereinheitlichte Plattform zur Verfügung stellen sollen, gehört auch die Adaptive Security Architecture, die höchste Sicherheitsstandards für alle Anwendungen zentral liefern soll. Der Vorteil: Dann muss man nur noch diese zentrale Plattform hacken, um an alles dranzukommen. Was für eine Effizienzsteigerung.
Und das alles soll schon 2017 Wirklichkeit werden! Geht es Ihnen nicht auch so? Man kann bei allem, was wir uns für die nächste und ferne Zukunft vorstellen, schon nicht mehr unterscheiden, ob es Perzeption ist oder Realität oder – Satire.