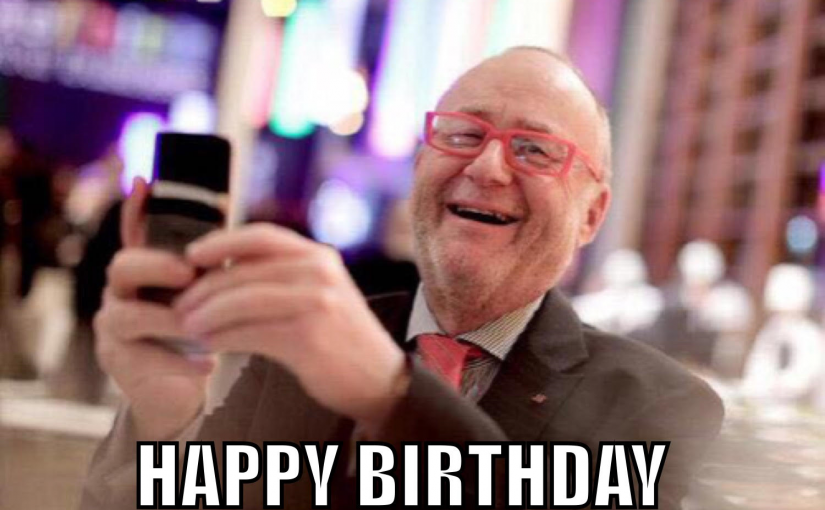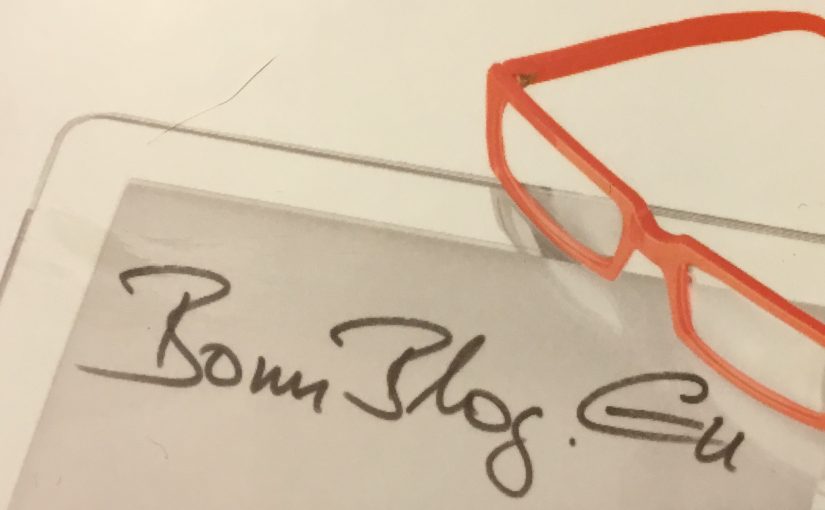Deutschland hat in Europa auch bei Startups die Nase vorn: Das geht aus Zahlen des Analystenhauses Ernst & Young hervor. Danach ist zwar London unverändert das Epizentrum der europäischen Gründerszene – unter den wichtigsten zehn Standorten in Europa befinden sich aber mit Berlin, München und Hamburg gleich drei Startup-Zentren. Zusammen genommen bringen sie es auf knapp zwei Milliarden Euro Investitionssumme allein im ersten Halbjahr.
Dabei ist Berlin trotz der stark föderalen Förderszene in Deutschland mit nur knappem Abstand die Nummer Zwei hinter London. Während Gründer in London in den ersten sechs Monaten 1,646 Milliarden Euro zusammentrommelten, waren es im gleichen Zeitraum in Berlin 1,47 Milliarden Euro. Paris als Drittplatzierter ist mit 683 Millionen da schon weit abgeschlagen. München (Platz 5 mit 183 Millionen Euro) und Hamburg (Sechster mit 178 Millionen Euro) folgen im ehrfürchtigen Abstand.
Dabei hat Berlin im europäischen Vergleich den größten Umsatzsprung getan: im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres waren es in der deutschen Hauptstadt „nur“ 531 Millionen Euro, die den Startups auf die Sprünge helfen sollten – ein Plus von 177 Prozent also. London hat im Vergleich dazu lediglich um 139 Prozent zugelegt, allerdings deutlich mehr Finanzierungsrunden absolviert. In Berlin fließt also im Durchschnitt mehr Geld pro Finanzierungsrunde.
Das Bild vom föderalen Förderstaat Deutschland wird auch durch den an diesem Montag erscheinenden fünften Deutschen Startup-Monitor (DSM) gefestigt, der neben den Startup-Hochburgen Berlin, München und Hamburg auch die Metropolregion Rhein/Ruhr sowie die Industriezentren Stuttgart/Karlsruhe und Ingolstadt/Nürnberg hervorhebt. Demnach sind zwar 16,8 Prozent der deutschen Startups in Berlin angesiedelt. In der Rhein/Ruhr-Region sitzt aber schon jedes neunte Startup. Im Ländervergleich liegt NRW mit 14,4 Prozent aller Startups auf Patz zwei hinter Berlin, aber vor Bayern (13,4 Prozent), Baden-Württemberg (12,4 Prozent) und Niedersachsen mit zwölf Prozent.
Das ist umso bemerkenswerter, als die deutschen Startups außerhalb Berlins der Industrie folgen. Und tatsächlich heben der Deutsche Startup Verband und KPMG als Autoren des Deutschen Startup Monitor hervor, wie stark die Geschäftsideen hierzulande auf Business-to-Business-Modelle abzielen und Industriekunden als wichtigsten Markt ansehen. Startups wie der Lieferservice Delivery Hero, der im Mai noch einmal fast 390 Millionen Euro einsammeln konnte, sind eher die Ausnahme. Deutschland bleibt also seinen traditionellen industriellen Stärken auch im Gründungsgeschehen treu, wenn mehr als zwei Drittel der Startups auf Business-Kunden abzielen.
Dabei unterscheidet der DSM feinsinnig zwischen Nutzern und Kunden – und kommt damit dem Plattform-Gedanken moderner Web-Angebote nach. So zielt zwar mehr als die Hälfte der Startups auf den privaten Nutzer, erwartet aber, dass Industrieunternehmen daraus den Nutzen ziehen und zahlen. So richten sich beispielsweise Mobilitätsangebote an den privaten Menschen, Nutznießer sind jedoch stets die Betreiber großer Infrastrukturangebote wie Auto-Flotten, Parkhäuser, Navigations- oder Verkehrsleit-Systeme.
Und damit zeigen Startups, dass sie keineswegs eine digitale Spielerei sind, sondern inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil des digitalen Wandels, in dem sich die Gesamtwirtschaft befindet. Im Übrigen haben Startups in Deutschland laut DSM jeweils mehr als 13 Arbeitsplätze geschaffen und planen im Durchschnitt noch einmal je zehn Mitarbeiter einzustellen. Voraussetzung ist freilich, dass sich der eklatante Fachkräftemangel in Deutschland mildern lässt. Allein im ITK-Sektor sind derzeit 50.000 Stellen unbesetzt. Da ist es kein Wunder, dass sich Startups mehrheitlich dafür einsetzen, ausländische Fachkräfte ins Land zu holen. Ohnehin kommt jeder zehnte Gründer in Deutschland aus dem EU-Ausland.
Sowieso hat es den Anschein, dass die Startup-Szene in Deutschland eher trotz der aktuellen politischen Lage so sehr aufblüht. Denn es sind zusätzlich zum Fachkräftemangel die drei Klassiker der Wirtschaftsklagen, die auch die Gründer mehrheitlich umtreiben: zu viel Bürokratie, zu hohe Steuern und ein komplizierter Zugang zu Wachstumskapital. In allen vier Punkten wird die neue Bundesregierung – voraussichtlich in den Farben von Jamaika – deutliche Zeichen setzen müssen.
Übrigens, wenn am 24. September nur die Startups gewählt hätten, müsste sich FDP-Parteivorsitzender Christian Lindner heute fragen, ob er mit der Union oder mit den Grünen als Mehrheitsbeschaffer unter seiner Führung koalieren sollte. Auch diese Erkenntnis verdanken wir dem Deutschen Startup-Monitor.
Startups sind doch irgendwie anders. Aber auch das gehört zu unserem föderalen Fördersystem.