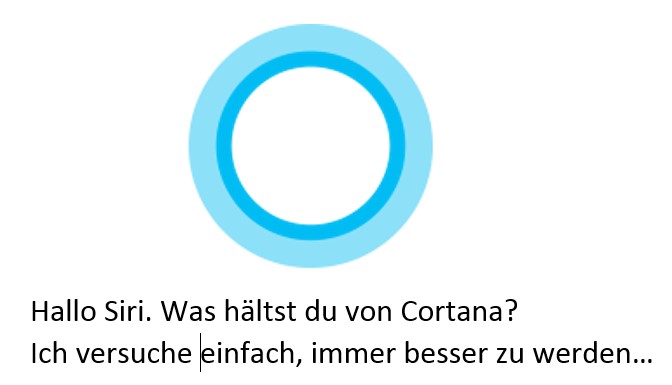Die Entwicklungsorganisation Oxfam will errechnet haben, dass die reichsten acht Männer auf diesem Planeten (ja, in der Tat, es sind ausschließlich Männer!) so viel Vermögen angesammelt haben wie die ärmere Hälfte der gesamten Menschheit. Unabhängig davon, dass die Datenbasis (von Credit Suisse) und die darauf aufbauende Bewertungsmethode angezweifelt werden können und auch von vielen angezweifelt werden, dominierte auf dem World Economic Forum in Davos doch der beklemmende Gedanke, dass die Schere zwischen arm und reich immer weiter auseinander geht und der ärmere Teil dabei nur zahlenmäßig zulegt.
Mehr als die Hälfte des Wohlstands, den die Menschheit derzeit angehäuft hat, war jetzt wieder in dem Schweizer Bergort vertreten – Grund genug für Oxfam, seine Zahlen genau dort vorzustellen und damit die Diskussion der rund 3000 Welt- und Unternehmenslenker zu beeinflussen. Und in der Tat – die Frage nach der gerechteren Verteilung der irdischen Ressourcen – seien es nun Rohstoffe, Finanzen, Gesellschaftsmodelle, Arbeitskräfte und Arbeitsplätze oder einfach nur Ideen – beherrschte die Debatte auf dem WEF. Ohne Moos ist nun mal auch in Davos nichts los.
Aber es geht auch um die Verteilung des zukünftigen Wohlstands, der vor allem denen winkt, die sich einen direkteren Zugriff auf die qualifizierteren Köpfe, detaillierteren Daten, ausgefeilteren Algorithmen und innovativeren Geschäftsideen verschaffen können. Schon im vergangenen Jahr machten Berechnungen mit einem negativen Arbeitsplatzsaldo von Davos aus die Runde. Diesmal berechnete KPMG, dass die Digitalisierung jeden zweiten Arbeitsplatz kosten könnte – oder zumindest fundamental verändern würde. Als wäre IBM die Welt in einer (wenn auch ziemlich großen) Nussschale, zeigte die Vorstandsvorsitzende Ginni Rometty auf, was sich da gerade vollzieht.
Denn IBMs wachstumsstarke Sparten rund um Global Business Solutions und dabei vor allem um das cognitive Computing mit Watson offenbaren zwei Arbeitsmarktprobleme: Nicht nur hat Big Blue für Zehntausende von Vertriebsbeauftragten – einst die Stoßtruppe des IBM-Erfolgs – keine adäquate Verwendung mehr. Sondern auch die KI-Anwendungen, die auf der Basis von IBM Watson entstehen, sorgen zwar für mehr Beratungs- und Behandlungsqualität in den Sparten, in denen sie eingesetzt werden, – allerdings um den Preis tausender Arbeitsplätze.
Ob Vishal Sikka (Infosys), Satya Nadella (Microsoft) oder eben Ginni Rometty – alle hatten die ethischen und ökonomischen Auswirkungen von Systemen der künstlichen Intelligenz auf die Agenda in Davos gebracht. Die IBM-Chefin präsentierte gar drei Grundsätze, denen sich IBM und besser auch die ganze Welt unterwerfen solle. Erstens: KI solle den Menschen helfen, nicht sie ersetzen. Zweitens: Wie KI-Plattformen gebaut, wie sie trainiert und eingesetzt werden, müsse stets transparent bleiben. Und drittens: KI-Systeme müssen immer mit den Menschen entwickelt werden, die in den Branchen und Tätigkeitsfeldern über die Expertise verfügen. Eine Anlehnung an die berühmten drei Robotergesetze des Wissenschaftlers und Science Fiction-Autors Isaac Asimov war dabei kaum zu übersehen.
Und ein bisschen Science Fiction ist die künstliche Intelligenz wohl derzeit immer noch. Denn „trotz des großen Hypes und trotz der langen Tradition in der KI-Forschung, die schon Jahrzehnte zurückreicht, stehen wir bei dem Thema noch immer am Anfang“, wurde Vishal Sikka nicht müde zu warnen. Noch biete KI kein tragendes Geschäftsmodell, hieß es in den Diskussionsrunden – weder für die Anbieter, noch für die Anwender. Noch haben die Projekte eher experimentellen Charakter, als dass sie einen klaren Fokus auf Geschäftsprozesse aufweisen.
Aber sollte es soweit kommen, dürfte sich der Druck nicht nur auf Jobs auswirken, die durch wiederholbare Tätigkeiten und Aufgaben mit geringer Qualifikation gekennzeichnet sind. Dann werden auch Arbeitsplätze, in denen Entscheidungen auf der Basis großer Datenmengen oder Arbeiten mit größtmöglicher Präzision gefordert sind, plötzlich disponibel. Es ist bemerkenswert, wie sehr selbst die Eliten von heute durch diese Auswirkungen verunsichert werden. Umso mehr also die, die sich ohnehin schon zurückgelassen wähnen. Auch darüber wurde in Davos besorgt diskutiert.
Denn – und auch das wurde in Davos diskutiert – dann gerät eine Jahrhundert-Gewissheit ins Wanken: Ohne Moos nichts los. Auch in Davos tauchte da auf einmal das Szenario vom voraussetzungslosen Grundeinkommen auf. Eigentlich hatte auch diese Denkschule schon Moos angesetzt. In Davos wirkte sie plötzlich wieder wie blank geputzt. Auch dazu hatten die Oxfam-Daten über die Verteilung des Wohlstands beigetragen – ob sie nun zutreffen oder nicht.