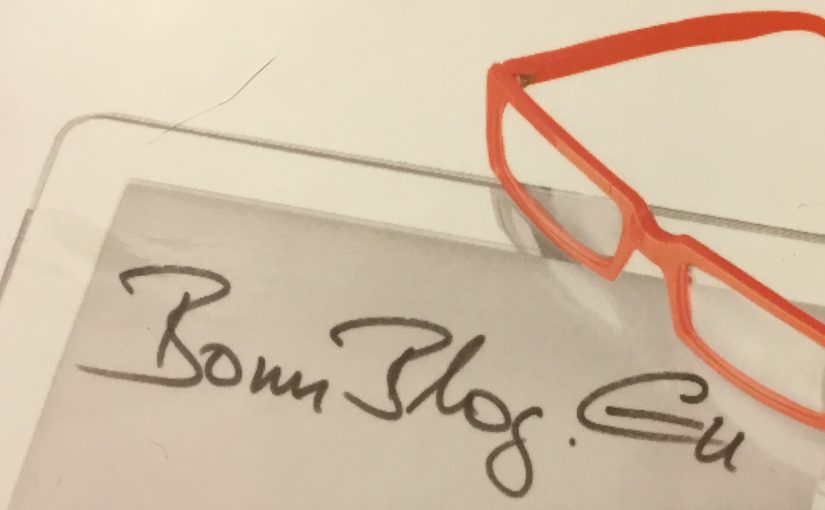Im Reformationsjahr, in dem daran erinnert wird, dass Martin Luther vor 500 Jahren seine berühmt gewordenen Thesen wider den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg hämmerte, gerät die Erinnerung an andere, vielleicht für den Weltenlauf minder wichtige Festlegungen bedauerlicherweise in den Hintergrund: So zum Beispiel die Verordnung Nr. 1234 der Europäischen Gemeinschaft über eine „gemeinsame Organisation der Agrarmärkte“, die vor ziemlich genau zehn Jahren verabschiedet wurde. Darin findet man auch „Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse“ wie etwa wie die Feststellung, dass ein Liter Milch – also das „Gemelk von einer oder mehreren Kühen“ – mit dem Fettgehalt von 3,5 Prozent mindestens 1028 Gramm pro Liter zu wiegen hat.
Wir wollen uns nun keineswegs über die Ordnungsliebe der Europäischen Kommission lustig machen – schließlich wünscht niemand das gepanschte oder gestreckte „Gemelk“, das bei nur 28 Gramm weniger pro Liter nur noch reines Wasser wäre – und damit etwas völlig anderes.
Aber allzu genaue – oder allzu vordergründige Kategorisierungen können in die Irre führen. Oftmals geht es vielmehr um gefühlte Unterscheidungen, die sich einer eindeutigen Definition entziehen. Die Europäische Kommission weiß zum Beispiel ganz genau, dass ein Unternehmen dann als mittelständisch zu bezeichnen ist, wenn es mit weniger als 250 Beschäftigten weniger als 50 Millionen Euro Umsatz generiert. Klein ist ein Unternehmen demnach, wenn es zwischen zehn und 49 Mitarbeiter beschäftigt und dabei zwischen zwei und zehn Millionen Euro umsetzt. Und „Kleinst“ nennt die Europäische Kommission jene Firmen, die bis zu neun Mitarbeiter haben und damit nicht über einen Umsatz von zwei Millionen hinauskommen. Jahr für Jahr geraten aber Hunderttausende von Unternehmen schon allein durch die Auswirkungen der Inflation in die nächsthöhere Kategorie, ohne dass sie real zulegen. Auch das ist eine Auswirkung des sogenannten Mittelstandsbauchs.
Die Einteilung ist auch insofern bemerkenswert, als einem Kleinstunternehmen damit ein Umsatz pro Mitarbeiter von bis zu 250.000 Euro zugetraut wird. Darüber hinaus wird aber eher ein Pro-Kopf-Umsatz von unter 200.000 Euro unterstellt. Tatsächlich sieht aber die Realität genau umgekehrt aus. Als Daumenregel kann gelten: Je größer ein Unternehmen ist, desto größer ist auch seine Produktivität gemessen am Pro-Kopf-Umsatz. Und es hat den Anschein, als würde die Europäische Kommission ihre Förderpolitik auch genau nach dieser Daumenregel ausrichten. So werden zum Beispiel 80 Prozent der Ausgaben, die im EU-Haushalt im Rahmen des Förderprogramms „Horizont 2020“ vorgesehen sind, an Großunternehmen vergeben, wie das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft betont.
Eine zweite Daumenregel besagt aber, dass kleine und mittelständische Unternehmen von Bürokratielasten stärker betroffen sind als Großunternehmen. Das liegt in der Natur der Sache: Der Aufwand für eine Betriebsgenehmigung beispielsweise ist die gleiche – unabhängig von der Zahl der Beschäftigten und der dabei erzielten Wertschöpfung. Der von der Entbürokratisierungsrunde um Edmund Stoiber geforderte „Bürokratie-TÜV“, der eine Gesetzesfolgenabschätzung mit Blick auf etwaige Bürokratiekosten betreiben sollte, ist leider bislang nur auf dem Papier verwirklicht. Zudem ist es unbestritten, dass global agierende Unternehmen mehr Möglichkeiten haben, Steuerabgaben dadurch zu verringern, dass sie Gewinne an einem Standort durch Verluste an einem anderen nivellieren können.
Es liegt in der Besonderheit der deutschen Wirtschaft – und wohl auch des deutschen Wirtschaftswunders, dass hierzulande die Definition von Mittelstand ganz anders formuliert wird als in der Europäischen Kommission. In Deutschland zählt auch zum Mittelstand, wer bis zu 500 Personen beschäftigt. Und darüber hinaus gehören auch deutlich größere Unternehmen zum klassischen Mittelstand, wenn sie Eigentum und Unternehmensführung verbinden – also in familiengeführten Firmen, die es in dieser Ausprägung in anderen europäischen Ländern gar nicht oder nur vereinzelt gibt. Hier könnte eine echte Mittelstandspolitik ansetzen. Denn das deutsche Erfolgsmodell ist ja – dies sei in aller Bescheidenheit, aber voller Selbstbewusstsein gesagt – durchaus nachahmenswert.
Denn ohnehin zeigt die Realität, wie wir sie aus Statistiken wahrnehmen, dass der Mittelstand – egal in welcher Definition – der Garant für Prosperität und Stabilität in Europa ist. Dies gilt es vor allem in Zeiten festzuhalten, in denen die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Aber es sind 23 Millionen kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (nach EU-Definition), die in der europäischen Staatengemeinschaft 90 Millionen Menschen „Lohn und Brot“ geben – das sind immerhin zwei Drittel aller Erwerbstätigen im Unternehmenssektor. Nimmt man den Agrarsektor hinzu, erhöht sich der Anteil sogar auf drei Viertel, denn trotz aller Konzentration in der Landwirtschaft wird der größte Teil der Erzeugerleistung von familiären Agrarbetrieben erbracht.
Mittelständische Unternehmen sind jedoch trotz des 2008 verabschiedeten „Small Business Act“ die Stiefkinder der europäischen Förderpolitik. Das sollte sich rasch ändern. Denn „Mittelstand First“ wäre eine vielversprechende Förderpolitik mit Blick auf die Digitalisierung. Auch hier gilt nämlich die Daumenregel, dass der Return on Invest bei Großunternehmen schneller eintritt als bei kleinsten, kleinen oder mittleren Unternehmen. Wer also lamentiert, dass Europa den Anschluss an die digitale Revolution zu verpassen droht, sollte vor allem diejenigen in ihre Weiterentwicklung fördern, die für die Beschäftigungssituation in der Europäischen Union den entscheidenden Beitrag leisten. Egal, wie die Kategorien definiert werden – „Mittelstand First“ ist Trump(f)!