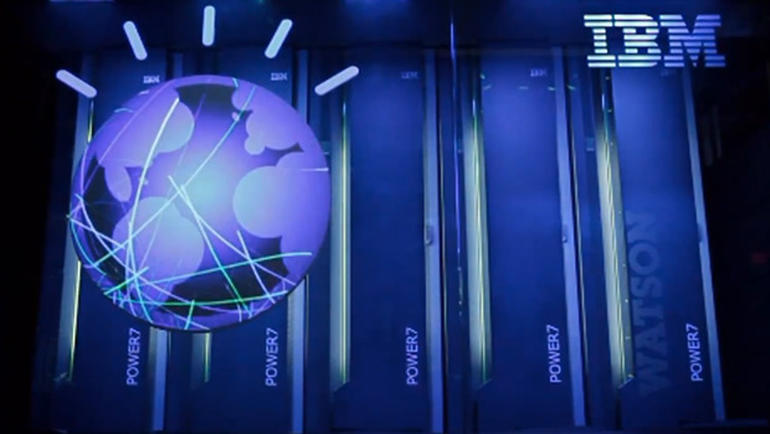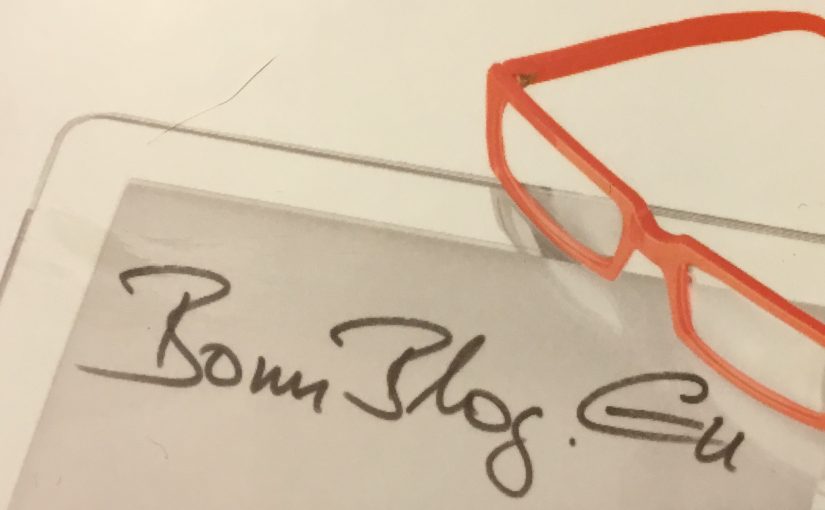Expertise entsteht aus Experimenten! Der im Grunde richtige Lehrsatz scheint zugleich das Credo der Bildungsexperten zu sein, die ständig an neuen Modellen arbeiten. Kaum hat eine Schulreform erste Ergebnisse gezeigt, wird sie durch die nächste bereits abgelöst. Aber es braucht nun mal Zeit, aus Fakten Wissen und aus Wissen Bildung wachsen zu lassen. Da ist es denn auch nur folgerichtig, dass mehr und mehr Bundesländer wieder zum neunjährigen Gymnasium zurückkehren.
Dass Bildung Zeit braucht, müssen auch die Schulungsexperten der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens erkennen. Je komplexer die Aufgabenstellung ist, desto langwieriger ist der Aufbau einer Computing-Umgebung für deren Bewältigung. Inzwischen zeigt sich, dass beispielsweise der schlagzeilenträchtige Sieg von IBMs Watson bei der Quizshow Jeopardy! doch ein relativ leichtes Unterfangen war im Vergleich zu den immensen Aufgaben, mit denen IBMs Auftraggeber die Plattform für das Cognitive Computing betrauen wollen. Neben schönen Erfolgen mehren sich inzwischen Nachrichten über abgebrochene oder gar fehlgeschlagene Projekte.
Um Maschinenstürmern gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen: Cognitive Computing und Deep Learning erzeugen keine Bildung – die bleibt uns Menschen vorbehalten. Aber diese und andere Formen der künstlichen Intelligenz revolutionieren die Verfügbarkeit von allokiertem Wissen und die Fähigkeit, aus Daten Informationen zu generieren und in großen Datenmengen Muster zu erkennen, aus denen wiederum Schlussfolgerungen gezogen werden können, die uns bei der Entscheidungsfindung unterstützen.
Das hat inzwischen einen unermesslichen Nutzwert. KI-gestützte Systeme erkennen in Netzwerken auffällige Verhaltensmuster, die auf einen Hackerangriff schließen lassen, und ergreifen Abwehrmaßnahmen. Das Potential allein ist immens: Wie der Hightech-Verband Bitkom jetzt mitteilt, ist allein in den vergangenen zwei Jahren rund die Hälfte der deutschen Unternehmen Ziel eines Angriffs geworden. Der dabei entstandene Schaden summiert sich in den zurückliegenden 24 Monaten auf 53 Milliarden Euro. Und dabei wird die Malware immer komplexer, so dass Virenscanner ohne Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz versagen. IBM hat jetzt ihr Wissen um Systeme und Netze aus 30 Jahren Projektgeschichte in einen Datenpool geleitet, aus dem Watson schöpfen soll. Die Datenbank unter dem Namen IBM Data Lake soll bei der Automatisierung der Systemadministration helfen und Hackern das Leben schwer machen.
Ein weiteres Paradebeispiel ist das Scannen von Millionen Seiten an Fachliteratur, die mit Hilfe der Fähigkeiten von IBMs Watson, natürliche Sprache auf ihren Inhalt hin zu analysieren und sich bei der Entschlüsselung der Semantik auch nicht durch syntaktische Sprachfallen wie doppelte Verneinung beirren zu lassen, ausgewertet werden. Ebenso sind KI-Systeme hervorragend geeignet, in Bildern typische Muster zu erkennen und damit Abweichungen von der Norm zu identifizieren. Beide Methoden helfen heute Ärzten und Wissenschaftlern in nahezu allen Disziplinen bei der Forschungsarbeit und der Diagnose von Krankheiten. Wenn auf diese Weise auch nur ein Menschenleben gerettet werden konnte, haben sich die Investitionen bereits gelohnt.
Und die Investitionen sind in der Tat immens: IBM allein hat einen zweistelligen Milliardenbetrag in die Entwicklung der Technologie hinter Watson gesteckt und dabei auch zahlreiche Firmenübernahmen gewagt. Aber die Marktchancen sind keineswegs geringer: Im Jahr 2025 sollen Unternehmenslösungen im Wert von 31 Milliarden Dollar verkauft werden. Darin ist die damit verbundene Wertschöpfung noch gar nicht berücksichtigt. Sie dürfte ein Vielfaches betragen.
Kein Wunder also, dass sich die Konkurrenz um die vordersten Plätze rangelt. Nach Einschätzung von Gartner ist IBMs Watson-Plattform die am weitesten entwickelte, doch Anbieter wie GE Digital, Microsoft, PTC und Amazon Web Services folgen auf dem Fuß. Und Internetgiganten wie Google und Facebook entwickeln eigene KI-Plattformen für den Eigenbedarf. Wie IBM wollen sie vor allem die eigenen Datenmengen gewinnbringend auswerten.
Dabei steckt die KI-Forschung auch 50 Jahre nach ihrer Begründung durch Marvin Minsky eigentlich noch in der Trial-and-Error-Phase – also am Beginn der Bildungskarriere. So verfolgen Cognitive Computing oder Deep Learning unterschiedliche Konzepte des Wissensausbaus und der Analyse, was sie keineswegs zu universell einsetzbaren Hochbegabten macht. Sie verfügen eher über singuläre Fähigkeiten, die sie für bestimmte Aufgaben optimal erscheinen lässt, für andere wie3derum nicht. Das ist eine typische Erkenntnis bei komplexen Unternehmenslösungen: Auch ERP-Systeme lassen sich nicht ohne weiteres heute im Maschinenbau und morgen in der Medizin einsetzen. Sie folgen kontextspezifischen Best Practices und keinen universellen Begabungen.
Das muss nun auch das Bildungssystem rund um die künstliche Intelligenz erkennen. IBMs Watson ist ebenso wenig ein Universalgenie wie es die KI-Angebote der Konkurrenten sind. Dass Googles KI-Ansatz den Weltmeister im Go-Spiel besiegt, bedeutet nicht, dass es jedes Spiel beherrschen kann. Aber es kann fahren (im autonomen Google-Fahrzeug) und antworten (über Android-Smartphones).
IBM wiederum versucht nun, Watsons Fähigkeiten zur Mustererkennung für die Prozesssteuerung im Internet der Dinge zu nutzen. Das wäre ein weiterer Riesenmarkt. Und der wäre auch nötig, denn bislang dürfte Watson trotz lukrativster Verträge mit Fortune-500-Unternehmen kaum mehr eingespielt haben als die Kapitalkosten. Mit IoT könnte sich jedoch ein niedrigschwelliger Bildungssektor anbieten, für den man nicht gerade das KI-Abitur benötigt.
Denn für IBM verrinnt die Zeit. Nicht nur wächst die Konkurrenz. Nach 21. Quartalen mit Umsatzrückgang schmilzt auch die Marktbedeutung. Gut, dass die jüngsten Anstrengungen zur Verschlankung die Kosten so weit senken, dass unverändert Gewinn ausgewiesen werden kann. Sonst heißt es für IBMs Watson in wenigen Quartalen wirklich nur noch: „So what?“