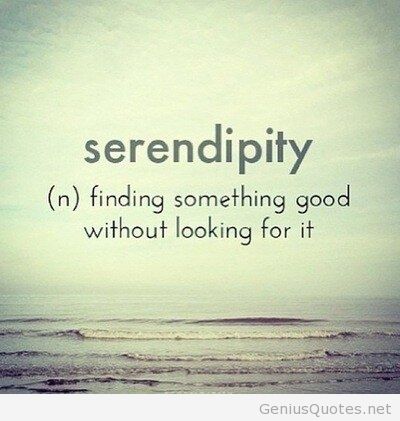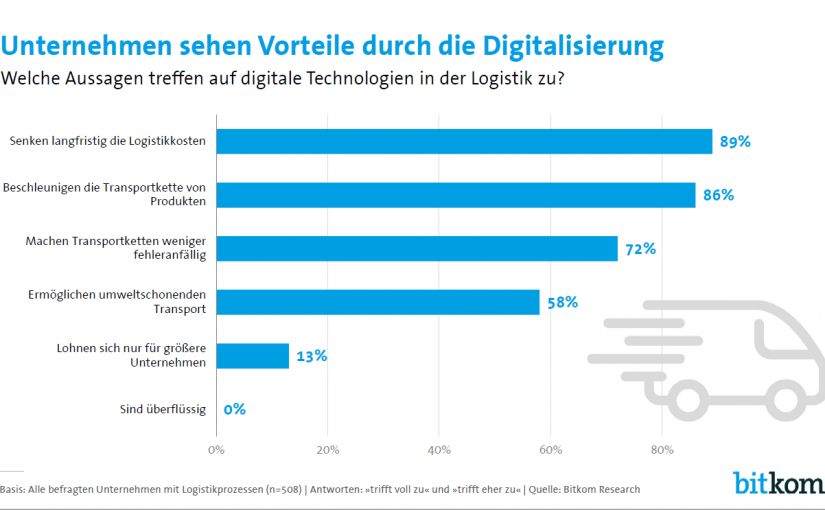Was haben Amerika, die kosmische Hintergrundstrahlung, Viagra, Nylonstrümpfe und Sekundenkleber gemeinsam? – Nun, dies alles sind Funde auf der Suche nach etwas anderem. Kolumbus war auf der Suche nach dem Seeweg Richtung Indien; die kosmische Hintergrundstrahlung wurde zunächst als Störgeräusch beim Testen einer Antenne wahrgenommen; Viagra war ursprünglich ein Mittel zu Behandlung von Bluthochdruck und Angina Pectoris; Nylonstrümpfe waren nicht das erste Anwendungsbeispiel für Polyamide, aber deren erfolgreichstes; und die klebrige Eigenschaft von Cyanacrylat wurde zunächst als störend empfunden, ehe dieses „Feature“ als Sekundenkleber zum eigentlichen Verkaufsschlager wurde.
Alle diese Innovationen verbindet die Tatsache, dass ihnen der sprichwörtliche „glückliche Zufall“ zur Seite sprang, der allerdings nur „den vorbereiteten Geist begünstigt“. Will sagen: Nur wer sucht, kann auch finden. Ganz schnell sei noch erwähnt, dass dieses Phänomen seit gut 150 Jahren „Serendipität“ genannt wird, benannt nach dem Sanskrit-Wort für die Insel Ceylon. Denn in nur wenigen Jahren werden wir dieses wunderbare Phänomen nur noch „Big Data Analytics“, „Machine Learning“ oder „Cognitive Computing“ nennen…
Künstliche Intelligenz ersetzt vielleicht nicht den vorbereiteten Geist, aber doch den glücklichen Zufall, indem klassische Suchmechanismen zu Findemethoden ausgebaut werden. Ob bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe in der Pharma-Industrie, bei der Diagnose seltener Krankheiten, bei der Hilfestellung am Arbeitsplatz oder beim autonomen Fahren oder Fliegen – KI ist im Begriff, überall den Zufall durch Analyse zu ersetzen.
Nirgendwo ist diese Entwicklung allerdings besser zu beobachten als im Handel, wo seit Jahrzehnten massenhaft gesammelte Konsumentendaten darauf warten, dass die richtigen Schlussfolgerungen zeitnah und zielorientiert gezogen werden. Handel definiert sich seit Jahrtausenden aus dem Ausgleich asymmetrischer Märkte, aus dem Wissensvorsprung des Verkäufers gegenüber dem Käufer, aus dem Ausgleich von Angebot und Nachfrage. KI bedient genau diese Eigenschaften und wird deshalb den Handel – egal ob im stationären Ladenlokal oder im Online-Shop – revolutionieren.
Dabei geht es gar nicht einmal darum, ob Drohnen künftig Waren ausliefern, Roboter im Baumarkt Kundenfragen beantworten, oder smarte Spiegel im Fashion-Shop dabei helfen, das richtige Outfit zusammenzustellen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden schon heute Preise individuell austariert – je nach dem Potenzial des Kunden und dem Wunsch, ihn zu binden. KI sorgt für mehr Marken-Loyalität, weil sie auf das individuelle Bedürfnis der Kunden ausgelegte Erlebniswelten erschafft. Und KI sorgt dafür, dass das individuell gestaltete Produkt genau dem Kundenwunsch entspricht – und zwar, bevor der Kunde diesen Wunsch überhaupt geäußert hat. Am Ende sucht nicht der Kunde nach seinem Produkt, sondern das Produkt findet seinen Kunden. Der „glückliche Zufall“ wird automatisiert.
Mit KI wird Marktforschung zur Meinungsforschung, die sich nicht aus einer Sonntagsfrage speist, sondern jeden Schritt und jede Entscheidung des Käufers analysiert. Nicht nur Amazon und Google experimentieren mit KI-gestützter Kundenanalyse, auch WalMart oder die großen deutschen Discounter optimieren inzwischen ihr Warenangebot und das Laden-Layout mit Hilfe von der Auswertung großer Mengen an Kundendaten. Davon profitieren vor allem globale Handelsketten, die nicht nur über deutlich mehr Datenmaterial verfügen, sondern auch über die notwendigen Economies of Scale, in denen die riesigen Investitionen überhaupt wirtschaftlich vertretbar sind – egal, ob am Point of Sale oder im Lieferservice.
Die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Handel steht sonderbarerweise im krassen Gegensatz zur Wahrnehmung der Kunden. Sie bemerken es kaum, wenn KI-Assistenten ihre Kaufentscheidung beeinflussen oder die Lieferung zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort erfolgt. Im Gegenteil: Nur 15 Prozent der Deutschen glauben, dass KI-Technologie einen tatsächlichen Nutzen erbringt. Damit lebt der Handel auch weiterhin von der Asymmetrie: der Verkäufer weiß mehr als der Käufer – nur auf höherem Niveau.